
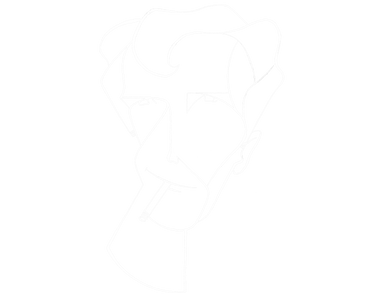
Der, der du niemals sein wirst
Die Nacht meines Lebens
ADHS-Kolumne, Folge 13 – Eine unfertige Skizze zu Sonnenaufgängen am Ende und am Anfang der Zivilisation.
Von Constantin Seibt, 10.09.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Sehnsucht geht erstaunlich oft in Erfüllung. Nur oft anders als erträumt.
In den Jahren der Pubertät sehnte ich mich nach der Revolution, dem Einschlag eines Kometen, dem Atomkrieg. Schlicht, weil mir kein anderer Weg einfiel, ein Mädchen kennenzulernen.
Das plausibelste Szenario fand ich in einem Science-Fiction-Sammelband. Titel und Autor (oder Autorin) habe ich vergessen. Aber die Geschichte lief so:
Dank verbesserter Rechenleistung der Computer machen Astronomen eine revolutionäre Entdeckung: Das Universum dreht sich um eine riesige zentrale Sonne. Dass diese bisher verborgen blieb, erklärt sich sehr einfach: Ihr Licht hat die Erde noch nicht erreicht.
Die Handlung setzt an dem Tag ein, als die Leute überall in New York geschwärzte Fernrohre aufstellen, weil es endlich so weit sein soll. Der Held ist ein junger Atomphysiker, der auf dem Dach des Laborgebäudes mit der unscheinbaren Institutssekretärin wartet.
Es ist fast Mittag, als plötzlich eine zweite, blutrote, sengende Sonne am Himmel erscheint, neben der die gewohnte verblasst. Die Hitze wird schnell unerträglich. Die Leute sind schockiert. Der Physiker ist noch schockierter, als er feststellt, dass der neue glühende Ball am Himmel nicht die neue Sonne ist. Sondern nur der Mond, der ihr Licht reflektiert.
Als die neue Sonne am Horizont aufgeht, fängt die Flagge am Gebäude Feuer. Der Wissenschaftler und die Sekretärin flüchten in den mit massivem Beton ausgekleideten, atomunfallsicheren Bunker im Keller. Sogar unter dem meterdicken Beton wird es heiss. Am ersten Abend steigen die beiden wieder aufs Dach.
New York ist nicht wiederzuerkennen. Die Hitze hat fast alles Metall geschmolzen. Von den Autos auf den Strassen sind nur bizarre Skulpturen übrig. Einige Wolkenkratzer sind zusammengekracht. Brände wüten. Am Hafen liegen Frachtschiffe wie gestrandete Wale. Der Meeresspiegel ist um zwei Meter gesunken.
Am Horizont färbt sich der Himmel tiefschwarz. Blitze zucken, und vom Himmel wachsen riesige Trichter Richtung Meer. Ein System gigantischer Tornados rast auf New York zu. Die beiden flüchten wieder in den Keller. Die halbe Nacht reisst ein ungeheurer Sturm am Gebäude.
Gegen Morgen wird es ruhiger. Das Gebäude ist zerfetzt, steht aber noch. Sonst nicht viel. Kein lebender Mensch weit und breit. Es gelingt ihnen, in der kurzen Pause bis Sonnenaufgang ein paar Vorräte zu finden. Dann färbt sich der Himmel erneut feuerrot.
Im Keller fällt das Notkühlsystem aus. Es wird fast unerträglich heiss. Der Physiker und die Sekretärin ziehen sich bis auf die Unterwäsche aus. Sie überstehen den Tag.
Dann wird es wieder Nacht. Ein Sintflutregen fällt durch das abbruchreife Gebäude. Der Physiker und die Sekretärin öffnen zwischen den Trümmern ihre letzte Konservendose. Dann sagt die Sekretärin: «Mich hat noch nie jemand geliebt. Bitte, küssen Sie mich.»
Er tut es, und sie schlafen miteinander. Endlich versiegt der Regen. Sie richten sich auf und sehen am Horizont den neuen Sonnenaufgang. Den letzten Sonnenaufgang der Menschheit.
Das ist der Grund, warum Nerds so viel Sympathie für die Apokalypse haben: Wir hoffen alle auf das Schicksal der Institutssekretärin. Für eine Nacht ist der Zusammenbruch der Zivilisation ein geringer Preis.
Und zu meiner Überraschung ging mein Traum in Erfüllung.
Wenn Bücher zur Bedrohung werden
Eigentlich war der Fall klar.
Wir hatten über ein Jahr geredet, uns dann einen Frühling und einen Sommer lang geküsst – aber um Mitternacht lachte sie, schüttelte ihre Haare von links nach rechts und ging.
Als der Herbst kam, sagte ich: «Wir trennen uns.»
Sie weinte, sagte aber nichts.
Und ich hörte mich sagen: «Aber vorher fahren wir noch in die Ferien.»
Zu meiner Verblüffung sagte sie zu. Und zu meiner Verblüffung kam sie – zwei Minuten bevor der Nachtzug Richtung Spanien fuhr. Und zu meiner Verblüffung redeten wir auf der Fahrt kaum ein Wort. Wir verbrachten sie in einem handtuchschmalen Bett unter dem Zugdach.
Am frühen Morgen stiegen wir in Portbou aus, gleich hinter der spanischen Grenze. Ein maurisches Fort erhob sich wie ein Scherenschnitt vor der Morgendämmerung.
Wir schulterten unsere Rucksäcke, liefen Richtung Meer und dann weiter entlang der Küste.
In der fremden Landschaft waren wir uns sehr ähnlich. Keiner von uns war vorbereitet. Keiner sprach ein Wort Spanisch. Das Einzige, was wir hatten, war eine Autokarte von ganz Spanien.
Das machte jeden Restaurantbesuch zu einem Wagnis. Wir bestellten irgendetwas. Erstaunlich oft ragten dann irgendwelche Tentakel aus dem Abendessen.
Am zweiten Morgen kauften wir eine Flasche Wasser, Brot, Käse, zwei Äpfel und zogen los. Kurz nach Mittag hatten wir unser Ziel fast erreicht – laut Karte lag es hinter drei grossen Buchten. Wir stoppten in der dritten.
Wir assen und gingen schwimmen, faul wie Seehunde.
Ende Nachmittag machten wir uns wieder auf den Weg. Der allerdings nach und nach verschwand. Die roten Felsen stürzten nun direkt ins Meer, und plötzlich blieb uns nichts anderes übrig, als ernsthaft zu klettern. Ich war fast oben, als ein Brocken, so gross wie eine kleine Kommode, unter meiner linken Hand abbrach und mit einem lauten Schmatzen im Meer versank.
Einen Moment baumelte ich an einer Hand zehn, zwölf Meter über der Brandung. In meinem Rucksack steckten rund ein Dutzend Bücher – meine Versicherung für den Fall, dass nichts passieren würde –, dann würde ich in den Nächten wenigstens lesen können. Nun zogen sie mich in den Abgrund.
Ich griff mit der linken Hand nach der letzten stehen gebliebenen Felszacke. Ohne viel Zuversicht, dass sie halten würde.
Seit Jahren hatte ich mich gefragt, was ich wohl im Augenblick meines Todes denken würde. Das Ergebnis war enttäuschend nüchtern. Ich dachte: «Sie werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, meine Leiche zu bergen.»
Die Zacke hielt. Wir machten einen langen Umweg, und schliesslich standen wir gemeinsam auf der Felskuppe und sahen im Sonnenuntergang in weiter Ferne, weit grösser als gedacht, die drei weit geschwungenen Buchten.
Wir hatten höchstens ein Drittel des Wegs hinter uns.
«Wahrscheinlich sollten wir uns merken, dass es keine gute Idee ist, mit einer Autokarte wandern zu gehen», sagte sie.
Wir kletterten noch eine halbe Stunde über die Felsen, bis es dunkel wurde. Der Seewind blies nun herbstlich kühl. Wir sammelten Treibholz am Ufer und machten Feuer. Dann überprüften wir unsere Vorräte: eine zu einem Drittel volle Flasche Wasser und ein Apfel.
Die Nacht war gekommen, von der ich mein Leben lang geträumt hatte. Gut, wir befanden uns nur in milder Lebensgefahr. Dafür war die Landschaft ungeheuer: Himmel, Meer und Berge, alles auf einmal. Es war eine klare, windige Nacht, das Licht der Sterne leuchtete über den Pyrenäen, die vor uns in der Brandung versanken. Und wir waren verliebt.
Als wir genug Holz zusammenhatten, nahmen wir je einen sparsamen Schluck Wasser und teilten den Apfel. Ich weiss bis heute, wie er schmeckte. Dann drängten wir uns eng aneinander, aber nicht aus Leidenschaft, sondern wegen der Wärme. Irgendwann schliefen wir unruhig ein.
Das also war die Nacht meines Lebens: Zweimal wachte ich auf und legte Holz nach.
In der Morgendämmerung hatte ich einen Traum. Ich träumte, wir sässen zum Frühstück in einer McDonald’s-Cafeteria.
Der Beginn der Zivilisation
Die zwölf Bücher in meinem Rucksack blieben ungelesen. Bis auf das schmalste und leichteste: Platons «Gastmahl».
Wir lasen es uns gegenseitig vor, weil es von der Liebe handelte.
Ich kannte Platon nicht und erwartete … irgendetwas Schweres. Auf keinen Fall ein Buch so voller Leben wie eine Hafenkneipe.
Dabei verhaut Plato die ersten sieben Seiten komplett. Sie beschreiben, wie ein Bekannter beschreibt, wie Sokrates sich zum Haus des Gastgebers begibt – was nicht nur für den Rest der Handlung vollkommen unerheblich ist, sondern auch unfassbar wirr geschrieben.
Es ist – meiner Kenntnis nach – der miserabelste Anfang der Literaturgeschichte. Doch die restlichen siebzig Seiten sind unvergesslich.
Sie laufen so:
Kaum ist Sokrates – erheblich verspätet – angekommen, debattieren die Griechen, ob sie sich wie am vorherigen Abend volllaufen lassen sollen. Sie entscheiden sich dagegen, die meisten haben noch einen Kater. Und beschliessen stattdessen einen Redewettbewerb: zu Ehren von Eros, dem Gott der Liebe.
Nun legt einer nach dem andern los: Der Erste preist Eros als den Gott, der einem mehr Mut fürs Leben verschafft (und im Krieg mehr Mut fürs Sterben), weil man sich vor dem Geliebten nicht als feige zeigen will. Der Zweite kritisiert die barbarische Liebe – und preist die edlere Knabenliebe, die sich auch für die Seele interessiert. Nummer drei, ein Arzt, rät aus Gesundheitsgründen zur Mässigung: in der Leidenschaft wie auch in allen anderen Dingen.
Dann spricht der Komödiendichter Aristophanes: Ursprünglich waren die Menschen kugelartig zusammengewachsen, als Mann-Mann, Frau-Frau, Mann-Frau. Da sie stark, selbstzufrieden und schnell wie rotierende Räder unterwegs waren, griffen sie die Götter an. Zur Strafe liess sie Zeus in zwei Hälften sägen. Nun suchte jedes Bruchstück verzweifelt nach der verlorenen Hälfte. Ohne auf Nahrung zu achten, starben alle wie die Fliegen. Zeus sah, dass er zu weit gegangen war: ohne Menschen weder Ehrungen noch Opfer. Also packte er ihr Geschlechtsteil – davor trugen es die Menschen am Rücken und zeugten in die Erde «wie die Zikaden». Und rückte es auf die Vorderseite. Sodass die Menschen für kurze Zeit zu ihrer ursprünglichen Natur zurückkehren konnten. Indem für kurze Zeit aus zweien wieder eins wurde. (Kein Wunder, mahnt Aristophanes am Ende der Rede zu Frömmigkeit: Denn sonst werde die Menschheit noch einmal zersägt.)
Danach spricht Agathon, der Gastgeber: eine wuchtige Blumenrede, in der Eros als tatkräftig, klug und vornehm, überhaupt als grösster, schönster, menschenfreundlichster der Götter gepriesen wird.
Schliesslich ist Sokrates an der Reihe. Und man fragt sich: Kann er das Ganze noch steigern? Die Antwort ist: Er steigert es nicht. Er bläst es weg.
Zunächst gibt er zu, dass er als junger Mann alle Gedanken seines Vorredners geteilt habe. Und Eros für schön, klug und einen grossen Gott hielt. Bis er in Arkadien auf die Priesterin Diotima traf. Die ihn von einer ganz anderen Lage der Dinge überzeugte.
Denn zum Ersten, habe Diotima referiert, kann Eros, der Liebende, weder schön noch gut sein. Denn wer das Schöne und Gute besitzt, muss nicht danach suchen. Man sucht nur nach dem, was einem mangelt.
Was nicht heisst, dass er hässlich und schlecht ist. In Wahrheit, sagt sie, ist Eros weder noch. Nicht schön, nicht hässlich. Und weder gut noch schlecht. Und deshalb auch kein Gott – weil Götter nicht inkomplett sein können.
Er ist, so Diotima, ein Dämon: eines der vielen Halbwesen, die zwischen der Welt der Götter und derjenigen der Menschen vermitteln. Er ist der Sohn zweier sehr verschiedener Eltern: Sein Vater ist Poros, der Jäger, verwegen, trickreich, ein grosser Fallensteller, Giftmischer und Redner. Seine Mutter ist Penia, die Armut.
Eros wurde nach dem Fest der Götter zur Geburt der Aphrodite gezeugt, als Poros berauscht im Garten schlief und Penia kam, um Reste zu erbetteln. Sie sah den schlafenden Poros und spürte das Verlangen, von ihm ein Kind zu empfangen, hob ihre Lumpen und setzte sich auf ihn.
Eros wurde der getreue Sohn seiner Eltern: nicht zart, nicht schön, wie die Leute glauben, sondern rau, ungepflegt, barfuss, ewig unterwegs, ohne anderes Dach als den Himmel. Doch dabei stellt er wie sein Vater täglich dem Schönen und Guten nach, unerschrocken, ein Glücksspieler und Liebhaber der Weisheit.
Weder Gott noch Mensch, ist er weder sterblich noch unsterblich: Über Wochen stirbt er dahin – und blüht auf, wenn er Erfolg hat: Aber was er gewinnt, verrinnt wieder. Findig und dumm, ist er ewig auf der Jagd.
Es wäre allerdings ein Fehler, so die Priesterin, dass das Begehren sich nur auf den Besitz des Schönen und Guten beschränkt. Denn wer liebt, will mehr: das Geliebte in Ewigkeit besitzen.
Und weil die Liebe auf die Ewigkeit gerichtet ist, ist ihr Ziel stets das Unsterbliche. Nicht umsonst sind Tiere und Menschen vor der Zeugung aufgeregt – sie selbst sind sterblich, aber das Unsterbliche liegt in der Zeugung und der Geburt.
Nicht der Besitz, sondern die Hervorbringung von Schönem und Gutem sichert einem Unsterblichkeit. Man hofft, sie in den eigenen Kindern zu finden. Aber auch in Werken und Taten. Nicht umsonst kennt die Sprache auch Liebhaber der Dichtung, der Musik, der Geldvermehrung, der Staatskunst. So wie Homer durch seine Epen unsterblich wurde oder Solon durch seine Gesetze.
Denn die Menschen, so die Priesterin, gehen nicht nur mit dem Leib, sondern auch mit der Seele schwanger: Sie wollen gebären. Und deshalb suchen sie voller Sehnsucht nach Schönheit. Denn nur im Schönen lässt sich gebären – im Hässlichen klappt das nicht. Alles zieht sich zusammen, und man trägt schwer an seiner Leibesfrucht.
Und deshalb sucht jeder Sterbliche sein Leben lang – erst nach schönen Leibern, dann nach schönen Gesprächen und Seelen. Und schliesslich, falls man so weit kommt, sieht man Schönheit nicht mehr in der Vielheit, sondern das Schöne selbst: als etwas Unvermischtes, ohne Fleisch, Zufall, Einsprengsel und andere vergängliche Dinge.
Dann wäre man wirklich der Liebe der Götter wert und im Reich von Wahrheit und Unsterblichkeit.
Kaum ist Sokrates mit seiner Rede fertig, unterbricht ihn ein enormer Lärm, eine Horde Besoffener stürmt das Haus, und der Anführer, der Feldherr Alkibiades, hält eine empörte Rede, diesmal auf Sokrates. Den er, wo er doch der eleganteste Jüngling von Athen ist, zu verführen versucht hatte, erst durch Passivität, dann durch Einladungen zum Abendessen, dann durch gemeinsamen Sport und intensives Ringen, schliesslich durch gemeinsame Übernachtung – aber alles vergeblich.
Daraufhin wird doch noch heftig getrunken, einer nach anderem sackt in den Schlaf, bis in der Morgendämmerung nur noch Aristophanes, Sokrates und sein Liebling Agathon wach sind. Und Sokrates die beiden dazu bringt, zuzugeben, dass jeder, der eine Tragödie schreibe, auch Komödien schreiben müsse.
Worauf auch sie einschlafen und Sokrates sich erhebt, sich ins öffentliche Bad begibt und dasselbe tut wie jeden Tag.
Fazit
Entschuldigung für die lange, trotzdem zu kurze Zusammenfassung. Doch ich glaube, sie enthält das Wesentliche, was es zur Sehnsucht zu sagen gibt:
Du musst nicht perfekt sein, um zu lieben. Das Gegenteil ist die Voraussetzung.
Das Ziel ist nicht der Besitz von etwas, sondern die Möglichkeit zur Hervorbringung: eines Kindes, eines Gesprächs, eines Werks, einer Tat.
Aber diese Folge ist schon wieder zu lang. Mehr – und wie Platon genau brauchbar ist, um sein Leben (mit ADHS) auf die Reihe zu bringen: in der nächsten Folge.
Illustration: Alex Solman