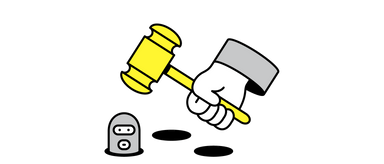
Die Narrenfreiheit der Freier
Wer einer Sexarbeiterin den Lohn verweigert, hat grosse Chancen, damit durchzukommen. Bringt das Bundesgericht diese überholte Rechtsauffassung endlich zu Fall?
Von Rolf Vetterli, 08.07.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Prostitution ist seit 1942, als das Schweizerische Strafgesetzbuch in Kraft trat, nicht mehr strafbar. Sexarbeiterinnen können sich auf das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit berufen und müssen ihr Einkommen versteuern. Dasselbe Einkommen wird aber als sittenwidrig bezeichnet, was bedeutet: Weigert sich der Kunde, die erotische Dienstleistung zu bezahlen, findet die Sexarbeiterin keinen gerichtlichen Schutz.
An diesem alten Zopf hängen vor allem noch gewisse Freier. Sie berufen sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichts. Doch in der Rechtslehre herrscht schon lange die Meinung vor, dass diese Auffassung nicht mehr tragbar ist.
Ort: Kantonsgericht St. Gallen
Zeit: 9. Januar 2020, 8.30 Uhr, Urteilsversand am 17. April 2020
Fall-Nr.: ST.2019.22-SK3
Thema: Betrug
Ein dreissigjähriger Student platzierte auf einem Online-Marktplatz folgende Anzeige: «Hallo Ihr Süssen, suche eine junge W (bis 25), welche 2000 Fr. verdienen möchte!» Auf diese Annonce meldete sich eine weibliche Person im passenden Alter, die anscheinend ebenso ahnungs- wie mittellos war, und fragte, was sie denn tun müsse.
Der Inserent, der sich Andreas nannte, teilte ihr mit, sie brauche bloss eine Nacht mit ihm zu verbringen. Die beiden verabredeten sich und fuhren zu einem Hotel, das in einem umgebauten Silo ohne Personal betrieben wird. Dort hatten sie mehrmals Geschlechtsverkehr. Als die erschöpfte Sexualpartnerin morgens um zwei Uhr erwachte, war der Freier ohne Bezahlung verschwunden und hatte die Datenspur auf ihrem Handy gelöscht.
Die Frau alarmierte die Polizei, welche sie mitleidig zum Bahnhof brachte. Erst dort entdeckte sie, dass ihr Portemonnaie leer war. Der Freier hatte ihr auch noch die letzten vierzig Franken entwendet. Bei einem erneuten Hilferuf meinten die Polizisten, nun könne sie wenigstens einen Strafantrag stellen – vorher war ihnen am Verhalten des Mannes offenbar nichts Strafwürdiges aufgefallen. Der Frau blieb nur noch eines übrig: schwarz nach Hause zu fahren, ihren düsteren Gedanken nachzuhängen und den Rat der Polizisten zu befolgen.
Die Staatsanwaltschaft fand Andreas bald und klagte ihn unter richtigem Namen an: wegen Betrugs, Datenbeschädigung und geringfügigen Diebstahls. Sie warf ihm insbesondere vor, er habe die Bereitschaft, den vereinbarten Preis für intime Kontakte zu zahlen, nur vorgespiegelt, und das sei eine arglistige Täuschung. Das Kreisgericht St. Gallen verurteilte den Freier antragsgemäss zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 110 Franken, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem verpflichtete es ihn, der Zivilklägerin Schadenersatz im Umfang von 2040 Franken zu leisten.
Eine abstruse Geschichte
Der Freier akzeptierte das Urteil nicht, wandte sich ans Kantonsgericht St. Gallen und verlangte einen umfassenden Freispruch; verbunden mit einer Abweisung der Zivilforderung.
Vor der Berufungsinstanz bestritt er sämtliche Vorwürfe und trug seine eigene Version vor: Er habe der Frau gleich nach dem Eintreffen im Hotel ein Couvert mit zwei Tausendernoten übergeben, wie es im Sexgewerbe üblich sei. Nach wiederholtem Geschlechtsakt habe er ein wenig Fussball geschaut und ein bisschen geschlummert. Dann habe er nochmals «seinen Spass haben» wollen. Die Frau habe aber gefordert, dass er dafür extra bezahle.
Als er sich geweigert habe, so Andreas weiter, habe sie ihm heimlich aufgenommene Fotos vorgelegt und mit einer Veröffentlichung gedroht. Da habe er seine Sachen gepackt und sei wortlos gegangen. Der Kammerpräsident hielt dem Studenten vor, dass er damals weder Einkünfte erzielt noch Vermögen besessen habe, und wunderte sich, woher der grosse Betrag im Couvert gekommen sei. Der Freier behauptete daraufhin, er habe jahrelang sämtliches Kleingeld in eine Vase gesteckt und diesen Sparbatzen verwendet, um sich nach dem Studienerfolg ein «Goodie» zu gönnen.
Allerdings hatte Andreas früher eine andere Version zum Besten gegeben: Er habe die Münzen in die Zählmaschine einer Bank geworfen. Vor dem Kantonsgericht änderte er diese Aussage und erklärte, das Kleingeld in Rollen verpackt und auf der Post gewechselt zu haben. Und was ebenfalls schlecht zur «Goodie-Variante» passt: Zum Zeitpunkt des erotischen Treffens im Silo-Hotel hatten die Abschlussprüfungen noch gar nicht begonnen. Es gab also für den Studenten keinen Grund zum Feiern.
Hier zeigt sich einmal mehr deutlich, wie schwierig es ist, eine plausible Geschichte zu erfinden und die Erzählung in mehreren Befragungen auch stringent durchzuhalten.
Ein Verstoss gegen die guten Sitten?
Die amtliche Verteidigerin versuchte, die Sache ihres Mandanten mit rechtlichen Argumenten zu retten: Wer eine Prostituierte um den abgemachten oder üblichen Lohn prelle, begehe gar keinen Betrug. Der Vertrag über die kommerzielle Verwertung sexueller Angebote gelte als unsittlich und sei daher nichtig. Eine Sexarbeiterin könne das versprochene Entgelt nicht einklagen, wenn der Freier nicht auf der Stelle bezahlt habe. Das Strafgericht dürfe das Zivilrecht nicht ausmanövrieren und den Betrugstatbestand heranziehen, um einem illegalen Geschäft doch noch zum Erfolg zu verhelfen.
So sonderbar diese Verteidigungsrede klingen mag – sie folgt durchaus einer juristischen Logik. Als sittenwidrig im Sinne von Artikel 20 des Obligationenrechts werden Abmachungen betrachtet, die gegen das allgemeine Anstandsgefühl verstossen. Dabei treten die Gerichte als Hüter der herrschenden Moral auf und bestimmen selbst, was die Mehrheit der recht und billig denkenden Menschen angeblich darunter versteht.
So erklärte das Bundesgericht noch im Jahre 2011 in einem obiter dictum – also mit einem ebenso unnötigen wie unbedachten Satz –, die Unsittlichkeit des auf entgeltlichen Geschlechtsverkehr gerichteten Vertrags sei «weiterhin zu bejahen». Diese wahrhaft altväterische Auffassung wirkt sich auch auf das Strafrecht aus.
Dort wird das Vermögen gewöhnlich definiert als «die Summe aller rechtlich geschützten Güter». Bekommt ein Freier für sein gutes Geld keine Gegenleistung, so ist er betrogen. Wird hingegen eine Prostituierte um ihren Verdienst gebracht, ist sie nicht geschädigt. Der sogenannte «Dirnenlohn» wird rechtlich nicht anerkannt und hat mithin auch keinen Wert.
Einige Professoren, lauter Männer, störten sich an dieser Diskriminierung und propagierten einen rein wirtschaftlichen Vermögensbegriff. Auch nicht legale Waren oder Dienstleistungen hätten ihren Preis. Ein sozialer Staat müsse für ein Mindestmass an Fairness auf grauen oder schwarzen Märkten sorgen. Das gehe zu weit, befanden andere Rechtsgelehrte: Am Ende könnten sich auch noch Menschenschmuggler oder Auftragskiller, die für die erfolgreiche Erledigung ihres Auftrags nicht belohnt wurden, als Opfer eines Betrugs ausgeben.
Geld stinkt nicht
Ein unpassenderes Kathederbeispiel hätte sich kaum finden lassen. Immerhin wird dabei doch etwas klar: Die Lösung kann nur darin bestehen, die Sexarbeit gesinnungsneutral als normale und geldwerte Tätigkeit aufzufassen. Vorstösse in diese Richtung gab es schon mehrere.
So erkundigte sich der FDP-Nationalrat Andrea Caroni vor acht Jahren, ob man den Prostituierten nicht endlich einen Rechtsanspruch auf ihren Arbeitsverdienst verschaffen sollte. Er hielt es für «scheinheilig», dass der Staat einerseits den Lohn der Sexarbeiterin als unmoralisch qualifiziere und andererseits fiskalisch davon profitiere. Das erinnerte ihn an den römischen Kaiser Vespasian, der eine Steuer auf Bedürfnisanstalten mit der Bemerkung «pecunia non olet» – Geld stinkt nicht – rechtfertigte.
Der Bundesrat liess sich von diesem ziemlich boshaften Vergleich nicht aus der Ruhe bringen und lehnte eine restriktivere gesetzliche Umschreibung der guten Sitten ab. Er räumte zwar ein, dass sich der gesellschaftliche Umgang mit der Massenerscheinung der käuflichen Liebe verändert habe, erwartete aber, dass die Gerichte einen solchen Wertewandel von sich aus nachvollziehen. Diese Hoffnung drückte er in seinem Bericht über «Prostitution und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung» von 2015 erneut aus. Sie hat sich noch immer nicht erfüllt.
Endlich erhält die Justiz wieder einmal Gelegenheit, sich zum Verhältnis von kollektiver Moral und sexueller Dienstleistung zu äussern. Den Anstoss dazu hat der falsche Andreas gegeben, der mit seinem Lockvogelangebot «ein Mädchen von nebenan» suchte, welches er dann offenbar als Gratisware benutzte und nach Gebrauch liegen liess. Applaus kann er dafür gewiss nicht erwarten.
Ein überfälliges Urteil
Und was steht nun im Entscheid des St. Galler Kantonsgerichts? Aufgeführt wird eine Reihe von Gründen, die für eine Gültigkeit der Sexdienstleistungsverträge sprechen:
Das Obligationenrecht ist vom Grundsatz der Vertragsfreiheit geprägt. Diese Freiheit, den Inhalt eines Kontrakts nach Belieben zu bestimmen, sollte nicht ohne Not eingeschränkt werden.
Der Vorbehalt der guten Sitten darf nur angerufen werden, um Verträgen, die ein «ethisches Minimum» missachten, die Durchsetzbarkeit zu verweigern.
Wichtiges Anliegen der Ethik ist die Verwirklichung von Gerechtigkeit. Diese wird nicht gefördert, wenn in einem Austauschverhältnis eine Partei systematisch benachteiligt und die andere bevorzugt ist.
Mehrere Kantone haben die Prostitution gesetzlich geregelt und als Beruf oder Gewerbe anerkannt. Dabei wird stillschweigend unterstellt, dass die in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Verträge gültig sind.
Sexarbeit wird mit Steuern belegt und mit Sozialabgaben belastet. Der Lohn ist pfändbar und der Erwerbsverlust nach einem Unfall kann als Schaden geltend gemacht werden. Der Staat verhält sich widersprüchlich, wenn er das gleiche Einkommen je nach Nützlichkeit das eine Mal akzeptiert und das andere Mal negiert.
So kommt das Gericht zum klaren Schluss, dass die weitverbreitete Form der Prostitution, die von Erwachsenen selbstbestimmt ausgeübt wird, respektiert werden müsse. Demnach sei die Betroffene, die das vereinbarte Entgelt nicht erhielt, in ihrem Vermögen geschmälert und vom Beschuldigten, der sie über seinen Zahlungswillen täuschte, betrogen worden.
Die Berufung wird abgewiesen. Doch der unterlegene Freier hat den Fall ans Bundesgericht weitergezogen. Man darf gespannt sein: Bald wird sich herausstellen, ob das oberste Gericht noch im viktorianischen Zeitalter stecken geblieben oder in der Gegenwart angekommen ist.
Illustration: Till Lauer