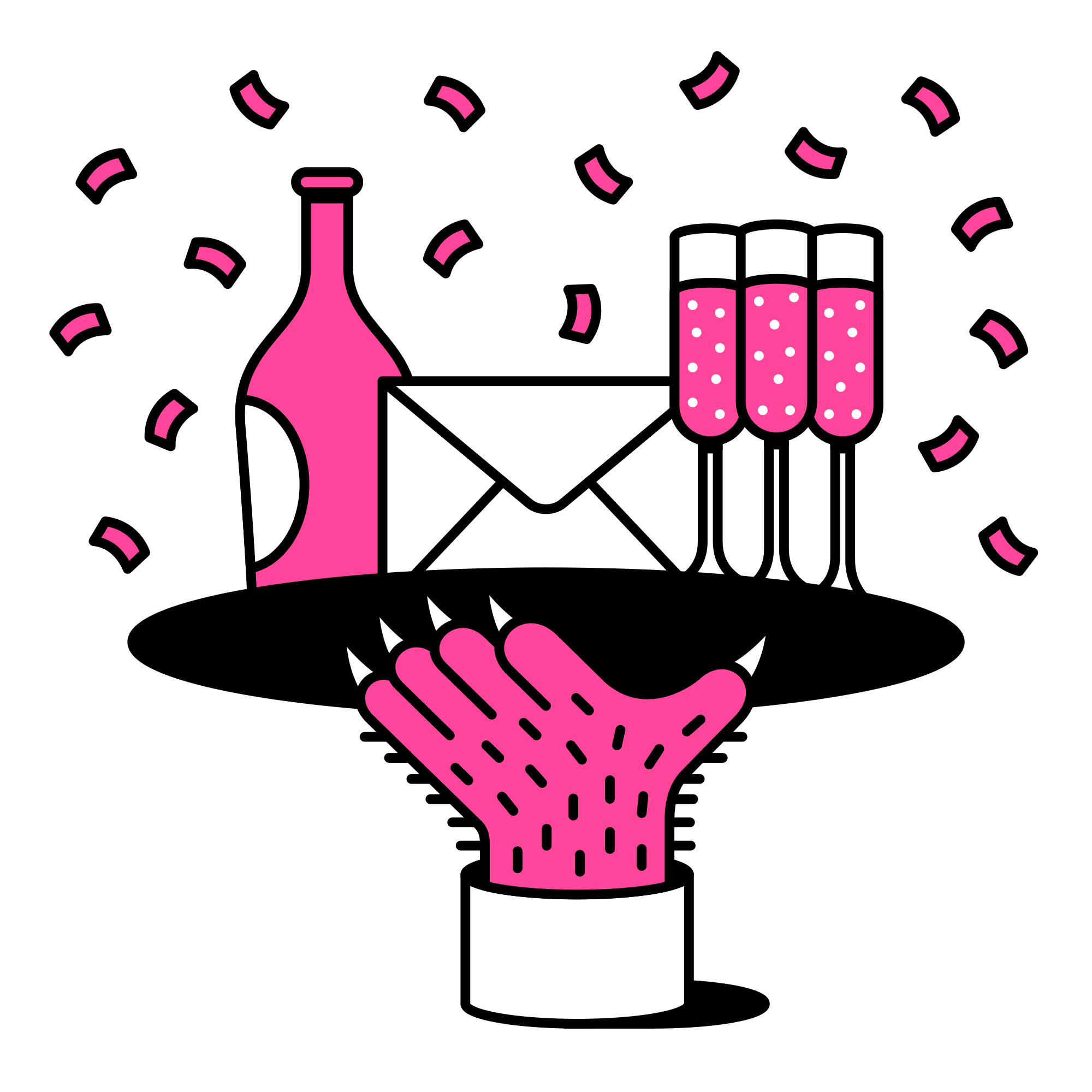
Die Sondernummer zur Sondersession
Das Parlament ist wieder da! Und wir immer noch. Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (100).
Von Philipp Albrecht, Andrea Arežina, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine, Olivia Kühni und Patrick Venetz, 07.05.2020
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Sehr geehrte Leserschaft. Sie lesen die 100. Ausgabe des «Briefings aus Bern».
Nicht dass wir jetzt allzu viel Aufheben davon machen wollen. Aber ein paar Worte sind zu diesem sehr runden Jubiläum wohl doch angebracht. Immerhin ist das «Briefing aus Bern» eines der ersten Formate aus der Anfangszeit der Republik. Dass es heute immer noch da ist, will etwas heissen – denn alles, was nicht gepflegt und gelesen wird und somit nicht längerfristig funktioniert, wird aussortiert. Das Briefing überlebte vier Chefredaktionen und diverse Diskussionen in den Redaktionsräumen im Rothaus. Braucht es das? Lohnt sich der Aufwand? Hilft das den Leserinnen? Nicht zuletzt, weil auch Sie uns immer wieder mitteilen, dass Sie das Briefing schätzen, existiert es nach 100 Ausgaben immer noch. Und wir geben uns Woche für Woche wieder dem mentalen Kraftakt hin, die «Dreisätze» – worum geht es, warum braucht man das zu wissen und wie geht es weiter – in für die Republik uncharakteristischer Kürze zu verfassen.
Die erste Ausgabe des «Briefings aus Bern» erschien im März 2018, mitten in der damaligen Frühlingssession, mit dem Titel «Frisches Blut und falsche Gene».
Einhundert Ausgaben, 810’000 Zeichen, 23 Autorinnen, 683 Dialogbeiträge, und mehr als zwei Jahre später ist das Ziel des «BaB» (so seine nicht sonderlich liebevolle, auf Effizienz getrimmte interne Bezeichnung) immer noch das gleiche wie zu Beginn: Wir durchforsten für Sie, liebe Leser, die Bundeshauspolitik der vergangenen Woche, suchen das aus unserer Sicht Relevanteste aus und fassen es so zusammen, dass Sie damit hoffentlich etwas anfangen können.
Mittlerweile ist das Briefing so etwas wie ein Hochseedampfer. Unbekümmert hält es seinen Kurs durch Wind, Wellen und Wetter. Die Beständigkeit zeigt sich auch, wenn man auswertet, wie häufig welche Begriffe genannt wurden. So dürfte es nicht gross überraschen, dass die «Schweiz» besonders gut abschneidet (854 Nennungen), der «Bundesrat» (532), das «Parlament» (370) oder der «Nationalrat» (337). Auch nicht, dass von den Kantonen «Bern» (197 Nennungen) am häufigsten erwähnt wird. Ein bisschen überrascht waren wir aber doch, dass das Wort «Angst» 12-mal vorkam, während die «Hoffnung» mit 9 Nennungen weniger Raum einnimmt. Wir schieben die Verantwortung dafür auf die Politik.
Und hoffen auf die nächsten hundert Ausgaben.
Ihnen danken wir sehr herzlich für Ihre Treue, Ihre Kritik und Ihre Debattenbeiträge.
Ihre bisherigen Autorinnen und Autoren: Adelina Gashi, Adrienne Fichter, Andrea Arežina, Andreas Moor, Bettina Hamilton-Irvine, Brigitte Hürlimann, Carlos Hanimann, Christof Moser, Cinzia Venafro, Daniel Ryser, Daria Wild, Dennis Bühler, Elia Blülle, Mark Dittli, Michael Rüegg, Oliver Fuchs, Olivia Kühni, Patrick Venetz, Philipp Albrecht, Ronja Beck, Simon Schmid, Sylke Gruhnwald und Urs Bruderer.
Und damit zum – Briefing aus Bern.
Transparenz: Ständerat will davon wenig wissen
Worum es geht: Bei der Sondersession im düsteren Bernexpo-Gebäude hat der oft als «Dunkelkammer» kritisierte Ständerat seinem Ruf alle Ehre gemacht. Eine für mehrere zehntausend Franken montierte elektronische Abstimmungsanlage liess er links liegen; stattdessen stimmten die Standesvertreterinnen mit Aufstehen ab.
Warum Sie das wissen müssen: Im Vorfeld der Sondersession hatte das Ständeratsbüro vorgeschlagen, die geheime Stimmabgabe einzuführen – es wäre ein Novum im modernen Bundesstaat gewesen. Nach medialer und social-medialer Empörung sah die kleine Kammer von ihrem Plan ab. Zwei Alternativen standen sich beim Sessionsstart am Montag gegenüber: Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann schlug vor, elektronisch abzustimmen und jeweils am Folgetag bekannt zu geben, wer wie gedrückt hat. Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch warnte davor, überstürzt die wiederholt abgelehnte volle Transparenz einzuführen – der Ständerat publiziert sonst vor allem Gesamt- und Schlussabstimmungen. Jositsch rief stattdessen alle Ja-Sager zum Aufstehen und alle Nein-Sager zum Sitzenbleiben auf. Jositsch setzte sich mit 25:20 Stimmen durch.
Wie es weitergeht: Befriedigend ist die Lösung nicht, die auch bei der ebenfalls in der Bernexpo stattfindenden Junisession zum Einsatz kommen soll. Zweifelsfrei festzustellen, wer wie abgestimmt hat, ist nicht möglich – denn nicht alle Ständeräte werden von den Fernsehkameras im Saal erfasst. Diesen scheint das egal zu sein, wehren sie sich doch seit je vehement gegen Transparenz. Und so wird wohl auch der neuste Sturm an ihnen vorbeiziehen, den ein Tamedia-Journalist so begründete: «Wer grosse Reden schwingt, soll auch zu seiner Meinung stehen. Man nennt das Demokratie.»
Luftfahrt: Das Parlament spricht 1,9 Milliarden Franken
Worum es geht: Sowohl der National- als auch der Ständerat haben sich an der Sondersession dafür ausgesprochen, die Schweizer Luftfahrt zu unterstützen. Die Airlines Swiss und Edelweiss erhalten insgesamt 1,275 Milliarden Franken, flugnahe Betriebe 600 Millionen Franken. Weil die aktuelle rechtliche Grundlage im Luftfahrtgesetz für die Unterstützung der flugnahen Betriebe nicht ausreicht, kommt es zu einer Gesetzesrevision.
Warum Sie das wissen müssen: Die Frage nach finanzieller Hilfe für die Luftfahrt hat stark polarisiert. Kommissionssprecher Christian Wasserfallen (FDP) wies darauf hin, dass die zu unterstützenden Betriebe systemrelevanten Charakter hätten. So seien 70 Prozent der Schweizer Firmen auf die Luftfracht angewiesen, und die Wertschöpfung der Branche betrage 30 Milliarden Franken. Grüne und SP wollten klima- und sozialpolitische Bedingungen – wie CO2-ärmere Flugzeuge oder zusätzliche Sozialauflagen – im Gesetz verankern, scheiterten aber mit allen Anträgen. Unzufrieden ist auch die Klimajugend, die am Dienstag auf dem Expo-Gelände eine Schilderdemo veranstaltete. In einer Mitteilung schreiben sie, es sei unmenschlich, Fluggesellschaften Steuergelder zu schenken, «während Tausende Menschen nicht einmal mehr genug Geld für Essen haben».
Wie es weitergeht: Die Gesetzesrevision tritt bereits heute Donnerstag in Kraft und gilt, falls nicht erfolgreich ein Referendum dagegen ergriffen wird, bis Ende 2025.
Medien: Parlament für Überbrückungshilfe
Worum es geht: Auch den Medien hilft der Bund durch die Krise: National- und Ständerat haben den Bundesrat diese Woche gegen dessen Willen beauftragt, ein Nothilfepaket zu schnüren. Sämtliche Parteien sprachen sich für eine Motion aus, die die sofortige Ausschüttung von 30 Millionen Franken Nothilfe für regionale Radio- und Fernsehsender verlangt. Alle Parteien mit Ausnahme der SVP unterstützten zudem eine zweite Motion, die verlangt, dass die Nachrichtenagentur SDA ihren Basisdienst all ihren Kunden unentgeltlich zur Verfügung stellt. Zudem soll die Post alle Lokal- und Regionalzeitungen gratis und alle überregionalen Tages- und Wochenzeitungen verbilligt ausliefern – sofern die Verlage für das Jahr 2020 auf die Auszahlung von Dividenden verzichten (ob der Dividendenfrage war in der Branche zuletzt heftiger Streit entbrannt).
Warum Sie das wissen müssen: Die meisten Medien sorgen sich um die Finanzen, weil viele Unternehmen wegen der Corona-Krise ihre Werbekampagnen gestoppt haben. Deswegen hat sich der Ruf nach staatlicher Unterstützung verstärkt, der zuvor schon lauter denn je geworden ist. Die Nothilfe soll nun gültig sein, bis die geplante ordentliche staatliche Unterstützung anläuft.
Wie es weitergeht: Exekutive und Legislative machen in dieser Frage Tempo, wie man das in Bundesbern kaum je gesehen hat. Nachdem der Bundesrat letzte Woche seine Vorschläge für die ordentliche staatliche Hilfe präsentiert hat, diskutiert die zuständige Kommission des Ständerats schon am kommenden Donnerstag darüber. Im Juni folgt die ganze kleine Kammer, im September der Nationalrat. Ergreift niemand das Referendum, könnten die Medien schon ab Anfang 2021 von der ausgebauten Zustell- sowie der neuen Onlineförderung profitieren.
Kurzarbeit: Ständerat versenkt Dividendenverbot
Worum es geht: Der Nationalrat verlangte vom Bundesrat, ein Dividendenverbot für Firmen einzuführen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Grössere Unternehmen sollten keine Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten dürfen, wenn ihre Angestellten von Kurzarbeit betroffen sind. Doch der Ständerat lehnte das Verbot ab.
Warum Sie das wissen müssen: Viele Arbeitnehmende, die wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit sind, stören sich daran, dass sie weniger verdienen, während Aktionäre weiterhin Dividenden kassieren. Doch der Bundesrat ist dezidiert gegen ein Dividendenverbot. Er lehnte eine entsprechende Motion von Mattea Meyer (SP) ab. Am Dienstag nahm der Nationalrat den Vorstoss aber knapp an. Neben den Grünen stimmten auch Vertreterinnen aus SVP und CVP für das Anliegen. Doch der Ständerat lehnte den Vorstoss mit 31 zu 10 Stimmen ab. Die kleine Kammer stellte sich auf den Standpunkt von Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der vor «verheerenden Folgen» für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft warnte. Ein Dividendenverbot hätte seiner Meinung nach zu Entlassungen und zu einer Belastung der Pensionskassen geführt.
Wie es weitergeht: Mit der Ablehnung im Ständerat ist die Motion erledigt.
Corona-App: Parlament fordert ein spezielles Gesetz
Worum es geht: Das Parlament hat den Bundesrat verpflichtet, erst eine gesetzliche Grundlage auszuarbeiten, bevor die Schweiz eine App zur Nachverfolgung der Corona-Infektionen breit einführen kann. In dem Gesetz soll etwa geregelt werden, wo die entsprechenden Daten gespeichert werden, wer darauf Zugriff erhält und dass die Nutzung freiwillig ist. Der Bundesrat sah im Epidemiengesetz eine ausreichende Grundlage.
Warum Sie das wissen müssen: Jedes staatliche Handeln braucht eine gesetzliche Grundlage – das ist einer der wichtigsten Grundpfeiler eines funktionierenden Rechtsstaates, weil es der Willkür vorbeugt. Während der Corona-Krise handelte der Bundesrat gestützt auf Sonderrechte, die ihm das Epidemiengesetz einräumt. Mit seinem Entscheid macht das Parlament nun deutlich, dass es staatspolitische Sorgfalt walten lassen will: Es gehe beim Contact-Tracing um einen potenziellen Eingriff in die Grundrechte, darum sei eine ausdrückliche Grundlage nötig, argumentierten die Nationalräte.
Wie es weitergeht: Die breite Einführung der App verzögert sich damit wohl auf Anfang Juli. Trotzdem soll eine erste Testphase wie vorgesehen in der zweiten Maihälfte beginnen – dafür reicht nach Ansicht des Parlaments das Datenschutzgesetz aus. Dann plant der Bundesrat auch eine Informationskampagne. Der verlangte Gesetzesentwurf dürfte in der Junisession für eine intensive politische Debatte darüber sorgen, unter welchen Bedingungen man eine Tracing-App in der Schweiz tatsächlich einsetzen will.
Geschäftsmieten: Parlament findet keinen Kompromiss
Worum es geht: Drei Tage lang feilschten National- und Ständerat um einen Ausweg aus der schwierigen Situation, in der sich viele Geschäfte seit Mitte März befinden. Damals mussten sie auf Geheiss des Bundesrats schliessen, schulden den Besitzern ihrer Geschäftslokale aber weiterhin den gewöhnlichen monatlichen Mietzins. Zwar anerkannte in den vergangenen Tagen eine Mehrheit beider Parlamentskammern die schwierige Situation der geschlossenen Betriebe – und die meisten Politikerinnen sahen Handlungsbedarf. Die Differenzen zwischen den Räten erwiesen sich aber als zu gross.
Warum Sie das wissen müssen: Der Bundesrat, der Läden und Restaurants per Notrecht geschlossen hatte, teilte vor Ostern mit, er wolle sich «nicht in die privatrechtlichen Beziehungen zwischen Mietern und Vermietern» einmischen. Die Mehrheit der Parlamentarier hingegen will dies durchaus. Doch der Teufel steckt im Detail: Während der Nationalrat eine Pauschallösung vorschlug, wonach die Mieter von Betrieben ihrem Vermieter grundsätzlich nur 30 Prozent der Miete schulden während der Zeit, in der sie wegen der behördlichen Massnahmen geschlossen bleiben müssen, ging das dem Ständerat zu weit. Mit 23:19 Stimmen bei einer Enthaltung sprach er sich gestern Nachmittag dafür aus, nur Mieter zu entlasten, deren Bruttomiete maximal 8000 Franken beträgt. Nach dem Willen der kleinen Kammer sollen diese Mieter während zweier Monate je 5000 Franken weniger bezahlen, die Nebenkosten aber vollständig entrichten müssen.
Wie es weitergeht: Weil sich National- und Ständerat nicht einig wurden, hält die teilweise existenzbedrohende Ungewissheit für Geschäftsmieter nun noch mindestens einen Monat an. Erst im Juni nämlich wird der Nationalrat über die vom Ständerat gestern Nachmittag nach dessen Willen abgeänderte Motion befinden. Ein Antrag des SP-Fraktionschefs Roger Nordmann, den Vorstoss noch gestern Abend zu behandeln, scheiterte in der grossen Kammer knapp mit 91:101 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Immerhin: Bereits einig sind sich National- und Ständerat, dass der Bundesrat einen mit 20 Millionen Franken geäufneten Härtefallfonds für Vermieter schaffen soll, die wegen der Mietausfälle in ihrer Existenz bedroht sind.
Die Premiere der Woche
Als «Premiere in der Schweizer Politgeschichte» kündigten die Parlamentsdienste ihre Idee an und fügten bedeutungsschwanger hinzu: «Besondere Zeiten verlangen nach besonderen Massnahmen.» Worum es ging? Nationalratspräsidentin Isabelle Moret und Ständeratspräsident Hans Stöckli beantworteten am Dienstag eine Stunde lang Fragen der Bevölkerung im Livechat, weil an der Sondersession wegen des Coronavirus keine Zuschauerinnen zugelassen waren. Ganz geheuer aber war dem Bund die womöglich unkontrollierbare Spontaneität der Bevölkerung nicht: Die Fragen mussten vorab eingereicht werden. Entsprechend uninspiriert ging die Übung vonstatten. «Ich bin sehr bewegt und glücklich, dass Sie mir die Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Und ich bin stolz, Schweizerin zu sein, weil wir dank unserer Regierung vor diesem schrecklichen Virus geschützt gewesen sind», begann die erste zugeschaltete Zuschauerin ihr mehrminütiges Statement. Wir geben es zu: Bis zur Antwort haben wir leider nicht durchgehalten.
Illustration: Till Lauer