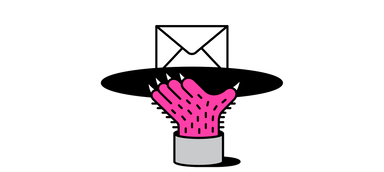
Neue Lockdown-Lockerungen, dem Bundesanwalt droht Amtsenthebung – und mehr Rassismus-Fälle
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (99).
Von Andrea Arežina, Elia Blülle, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine, Carlos Hanimann und Cinzia Venafro, 30.04.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Der Bundesrat will zurück in die Normalität – und zwar schnell. Gestern Nachmittag lud er gleich zu zwei Medienkonferenzen ein, um die neuesten Lockdown-Lockerungen zu verkünden.
Die wichtigsten Entscheide in der Übersicht:
Ab dem 11. Mai dürfen nun neben den Friseursalons auch Restaurants, Sportanlagen, Einkaufsläden, Bibliotheken und Museen unter Auflagen wieder öffnen. Der öffentliche Verkehr kehrt zum ordentlichen Fahrplan zurück. Zoos und botanische Gärten bleiben vorerst geschlossen.
Ebenfalls ab dem 11. Mai will der Bundesrat auch die Einreisebeschränkungen wieder leicht lockern. Unter anderem soll für Schweizer und EU-Bürger der Familiennachzug in die Schweiz wieder möglich sein. Trotzdem bleiben die Grenzkontrollen bestehen.
Präsenzunterricht ist an Primar- und Sekundarschulen ab dem 11. Mai wieder erlaubt. An Gymnasien und an Berufs- und Hochschulen hingegen dürfen bis zum 8. Juni bloss fünf Personen gleichzeitig unterrichtet werden. Auf fünf Personen beschränkt ist auch der Musikunterricht.
Die Gymnasien dürfen dieses Jahr auf die schriftlichen Maturaprüfungen verzichten; sie müssen aber nicht. Auch die Berufsmaturitätsschulen werden dieses Jahr keine schriftlichen Prüfungen durchführen. Stattdessen sollen die Erfahrungsnoten die Maturität bescheinigen.
Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben bis Ende August verboten. Ende Mai entscheidet der Bundesrat, ab wann kleinere Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen.
Der Bundesrat wird Ende Mai definitiv entscheiden, ob die Sport-Profiligen ihren Betrieb ab Juni vor leeren Publikumsrängen wieder aufnehmen dürfen.
Am 27. September 2020 sollen die Schweizer Bürger gleich über fünf eidgenössische Vorlagen abstimmen: die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz, die Steuerabzüge für Kinder, den Vaterschaftsurlaub und die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge.
Zwischen dem 11. Mai und dem 8. Juni wird es laut der Regierung zu keinen weiteren Lockerungen kommen. Der Bundesrat wolle nicht die Übersicht verlieren, betonte Gesundheitsminister Alain Berset. «Wir müssen flexibel bleiben und verhindern, dass die Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssen, wie es in anderen Ländern geschehen ist.»
Die Landesregierung will um jeden Preis verhindern, dass der Reproduktionsfaktor wieder steigt und jede infizierte Person mehr als eine weitere Person ansteckt. Eine zweite Welle hätte wohl einen erneuten Lockdown zur Folge – und das wäre für die Wirtschaft verheerend. Ohnehin sind die Prognosen für die Unternehmen düster. Wirtschaftsminister Guy Parmelin meinte, dass die Lockerungen zwar wie ein Morgenrot seien, es aber auch dunkle Wolken am Himmel gebe. So hätten sich die Firmen in den vergangenen Monaten stark verschuldet und es sei mit einer Rezession zu rechnen. «Besserung ist nicht wirklich in Sicht.»
Und damit zum Briefing aus Bern.
Swiss und Edelweiss erhalten 1,275 Milliarden Franken
Worum es geht: Die Geheimverhandlungen dauerten das ganze Wochenende, nun hat der Bundesrat kommuniziert: Die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss sollen mit insgesamt maximal 1,275 Milliarden Franken gerettet werden. Technisch ablaufen wird es wie bei den Corona-Krediten für die KMU: Die Banken zahlen das Geld, der Bund bürgt und garantiert. Die Risiken bei einem Kreditausfall tragen der Bund zu 85 Prozent, die Grossbanken zu 15 Prozent.
Warum Sie das wissen müssen: Das Rettungspaket für die Schweizer Luftfahrt ist an Bedingungen geknüpft: Die Airlines dürfen keine Dividenden ausschütten. Zudem muss das Geld in der Schweiz bleiben und darf nicht zur Sanierung der deutschen Muttergesellschaft Lufthansa verwendet werden. Die Swiss muss ihre Kredite also zuerst zurückzahlen, bevor sie wieder zur Cashcow für die Lufthansa wird. Die Anbindung Klotens und Genfs an den internationalen Luftverkehr und somit der Erhalt der Arbeitsplätze sollen garantiert werden, so Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga.
Wie es weitergeht: Der Bundesrat beantragt beim Parlament die Bewilligung dieser sogenannten Verpflichtungskredite, dieses wird wohl in der Sondersession kommende Woche darüber abstimmen. Sicher ist: Keine Freude am Rettungspaket haben Klimaschützer. Ihre Forderung, die Swiss-Rettung mit Klimaschutzzielen zu verbinden, hängt im luftleeren Raum. Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter kündigt an, die Vorlage zurückzuweisen und ein Referendum zu prüfen. GLP-Parteipräsident Jürg Grossen kündigt ebenfalls Widerstand an und fordert, dass der Vorschlag des Bundesrats mit klimapolitischen Auflagen ergänzt wird. Und auch die Verantwortlichen des Schweizer Klimastreiks kritisierten den Entscheid scharf.
Bundesrat will Medien mit Millionen fördern
Worum es geht: In einer direkten Demokratie ist die Informationsleistung der Medien besonders wichtig. Seit längerem leiden die Medien jedoch unter stark sinkenden Werbeerlösen (die Corona-Krise hat diesen Trend in den letzten Wochen massiv verstärkt). Die Verleger reagierten mit dem Abbau Hunderter Stellen und der Zusammenlegung von Redaktionen. Kurz: einer Verminderung der Medienvielfalt. Um die Rahmenbedingungen zu verbessern und ein vielfältiges Angebot in den Regionen zu fördern, hat der Bundesrat gestern beschlossen, die Medien mit einem Massnahmenpaket zu unterstützen. Die Unabhängigkeit der Medien bleibe gewahrt, versichert er. Neben einem Ausbau der indirekten Presseförderung von 30 auf 50 Millionen Franken pro Jahr sieht die Regierung eine Unterstützung von Onlinemedien mit jährlich 30 Millionen vor. Davon profitieren sollen aber nur jene Onlinemedien, die auf Erträge der Leserschaft zählen können – angerechnet werden Einnahmen aus dem Verkauf von Online-Abos und Tagespässen, aber auch freiwillige Beiträge.
Warum Sie das wissen müssen: Im Grossen und Ganzen bleibt der Bundesrat bei den Vorschlägen, die er im vergangenen August vorstellte. Wie von den grossen Verlegern um CH-Media-Chef Peter Wanner gefordert (zuletzt gestern in der Republik), werden neu alle abonnierten und via Post zugestellten Tages- und Wochenzeitungen subventioniert, die Auflagenobergrenze von 40’000 Exemplaren sowie die Kopfblattgrenze von 100’000 Exemplaren wird aufgehoben. Von der Onlineförderung profitieren die kleineren Verlage stärker als die grösseren, da der Umfang der staatlichen Unterstützung mit zunehmender Höhe des Umsatzes abnimmt. Die Förderung wird an formale Kriterien geknüpft: So müssen die Richtlinien des Schweizer Presserats anerkannt und es muss klar zwischen redaktionellen Inhalten und Werbung getrennt werden – der Bundesrat sagt hiermit der umstrittenen Werbeform Native Advertising den Kampf an. Ausserdem werden Aus- und Weiterbildungsinstitutionen (wie die Journalistenschule MAZ), nationale Nachrichtenagenturen (wie die SDA) und Selbstregulierungsorganisationen (wie der Presserat) unterstützt.
Wie es weitergeht: Das Massnahmenpaket geht nun zur Beratung ans Parlament. Die zuständigen Medienkommissionen von National- und Ständerat fordern wegen der Corona-Krise mit gleichlautenden Vorstössen gar ein dringliches Hilfspaket: Zeitungen sollen gratis zugestellt und Medien auf kostenlose Agenturmeldungen zurückgreifen können. Die Vorstösse dürften in der ausserordentlichen Session von kommender Woche behandelt werden.
Sondersession: Höhere Kosten – und Uneinigkeit über Programm
Worum es geht: Infrastruktur, Miete, Verpflegung, Sanität, zusätzliche Personalkosten und Sicherheit: Die Sondersession von kommender Woche wird voraussichtlich 3,1 Millionen Franken kosten. Mitte April ging der Bund noch von 1,5 Millionen aus. Doch allein die Miete für das Berner Messegelände sowie die Kosten für Sitzungsräume im Hotel Bellevue schlagen für eine Woche mit 2,1 Millionen Franken zu Buche. Dafür ist auf dem Gelände ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Menschen möglich. Hygienemasken dürfen getragen werden.
Warum Sie das wissen müssen: Die Frühjahrssession ist im März abgebrochen worden, weil im eng bestuhlten Bundeshaus der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Geplant ist nun aber nicht, die abgebrochenen Geschäfte an der Sondersession abzuschliessen. Bewilligen soll das Parlament vor allem die Corona-Notkredite, die der Bundesrat bereits gesprochen hat. So ist es im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehen.
Wie es weitergeht: Grünen-Fraktionspräsident Balthasar Glättli will für die kommende Bürositzung beantragen, dass in der Corona-Session auch die nicht fertig beratenen Geschäfte der abgebrochenen Session behandelt werden – zum Beispiel das CO2-Gesetz oder die Überbrückungsrente. Entscheidet das Büro des Nationalrats für eine Corona-only-Session, droht Glättli mit einem Ordnungsantrag im Plenum. Das definitive Programm soll am Freitagabend vorliegen.
Geheimtreffen, Rüge, Verjährung: Bundesanwalt droht Amtsenthebung
Worum es geht: Bundesanwalt Michael Lauber gerät noch stärker unter Druck. Mehrere Parlamentarier der Gerichtskommission bereiten derzeit einen Antrag vor, um Bundesanwalt Michael Lauber des Amtes zu entheben. Eine solche Amtsenthebung hat es noch nie gegeben.
Warum Sie das wissen müssen: Einst war er der Star der Schweizer Strafjustiz, doch seit über einem Jahr zerfallen Arbeit und Ansehen des Bundesanwalts wie Sandburgen: Medien deckten geheime Treffen und Absprachen auf, die Aufsichtsbehörde bezichtigte ihn der Lüge, rügte schwere Amtspflichtverletzungen und kürzte ihm den Lohn, und diese Woche verjährten grosse Prestigefälle, die sich um Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe der Fussballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland drehten. Seit «Das Magazin» Ende 2018 unprotokollierte Treffen zwischen Lauber und Fifa-Präsident Gianni Infantino enthüllte, befindet sich Lauber in der Defensive: An heikle Treffen konnte er sich nicht erinnern, auf Kritik reagierte er dünnhäutig, gegen die Aufsichtsbehörde geht er rechtlich vor. Dass er dabei auch noch denselben Anwalt auf Steuerzahlers Kosten engagierte wie Joseph Blatter im Fifa-Prozess, half ihm nicht, Sympathien zu gewinnen. Vergangenen Herbst empfahl die Gerichtskommission, den Bundesanwalt nicht wiederzuwählen. Die Bundesversammlung sprach ihm trotzdem für vier weitere Jahre das Vertrauen aus. Jetzt wollen Parlamentarier aus der Gerichtskommission den Entscheid korrigieren – und ihn des Amtes entheben.
Wie es weitergeht: Am 13. Mai tagt die Gerichtskommission des Parlaments. Dann wird aller Voraussicht nach ein Antrag auf Amtsenthebung eingereicht und behandelt werden. In der Woche darauf würde Lauber zur Stellungnahme eingeladen und die Kommission über den Antrag entscheiden. Frühestens in der Sommersession Mitte Juni könnte die Bundesversammlung über eine Amtsenthebung entscheiden.
Anstieg von Rassismus-Meldungen in der Schweiz
Worum es geht: So viele Meldungen wegen rassistischer Diskriminierung wie im vergangenen Jahr gab es in der Schweiz bisher noch nie.
Warum Sie das wissen müssen: Bei den 22 Beratungsstellen wurden im vergangenen Jahr 352 Fälle gemeldet, wie es im Bericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und des Vereins Humanrights.ch heisst. Das ist eine Zunahme von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten rassistischen Diskriminierungen fanden im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz statt. Als häufigstes Motiv wird generelle Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit angegeben, gefolgt von Rassismus gegen Schwarze und Muslimfeindlichkeit. Zudem gab es im vergangenen Jahr mehr Fälle infolge von Rechtsextremismus.
Wie es weitergeht: Die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus betont, dass die Zunahme der gemeldeten Fälle nicht bedeute, dass der Rassismus in der Schweiz zugenommen habe. Gleichzeitig nennt sie die gemeldeten Fälle nur die Spitze des Eisberges und sagt: «Die Dunkelziffer liegt deutlich höher.»
Die Ausbürgerung der Woche
Dieses Jahr hat die Schweiz ein Instrument im Kampf gegen Terroristen wiederentdeckt, das sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr angewandt hatte: Sie bürgerte eine Schweizer Staatsbürgerin aus Genf aus, die sich in Syrien dem IS angeschlossen haben soll. Der Berner Rechtsprofessor Alberto Achermann wies im Februar in der Republik darauf hin, dass dies aus verschiedenen Gründen problematisch sei. Vor allem aber sei es falsch, dass das Kriterium für eine Ausbürgerung eine Doppelbürgerschaft ist. «Am Ende geht es nur noch um die Frage: Welcher Staat ist schneller beim Ausbürgern?», sagte er. Und hatte recht damit: Denn wie Recherchen von SRF nun zeigen, ist Spanien der Schweiz in einem aktuellen Fall zuvorgekommen. Weil sich Daniel D., ein in Genf geborener schweizerisch-spanischer Doppelbürger, 2015 dem IS angeschlossen hatte, leiteten die Bundesbehörden ein Verfahren ein, um ihm das Schweizer Bürgerrecht zu entziehen. Nun zeigt sich aber, dass Daniel D. den spanischen Pass bereits verloren hat. Spanien betont zwar, dies habe nichts mit Terrorismus zu tun. Und sagt sich wohl trotzdem: «De Schnäller isch de Gschwinder.»
Illustration: Till Lauer