
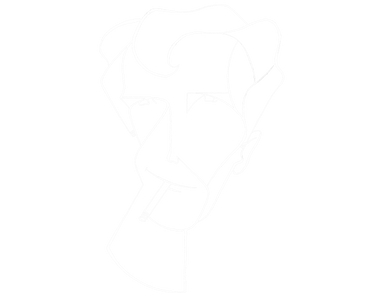
Der, der du niemals sein wirst
Das Vierbuchstabenwort
Die ADHS-Kolumne, Folge 6 – Was bringt eine ADHS-Diagnose an Erkenntnis? Ausser dass man eine ADHS-Diagnose hat?
Von Constantin Seibt, 09.04.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Heinrich von Kleist schrieb einmal: Wenn alle Menschen stets eine grüne Brille aufgesetzt hätten, würden sie die Welt für grün halten.
So ist es auch bei ADHS. Es ist keine Krankheit, die kommt und geht, sondern eine Konstante. Man könnte sagen, eine Art aufgeschnalltes Kaleidoskop.
Deshalb hat man keine Ahnung, dass man es hat. Doch sobald man eine Diagnose bekommt, sieht man es überall.
Etwa zu Beginn meiner Schulkarriere in der schon halb vergessenen Anekdote, dass man mich beinahe nicht vom Kindergarten in die Primarschule versetzt hätte. Weil ich beim entscheidenden Test 17 von 20 Aufgaben falsch hatte – korrekt waren nur die 3 letzten und schwierigsten Aufgaben. (Was mich rettete, war eine energische Ansprache meiner Mutter.)
Oder ganz am Ende in folgendem Porträt in der Maturzeitung:
Wer kennt ihn nicht? Sein hüpfender Gang, sein verklärt-durchgeistigt-abwesender Blick durch seine dicke Intellektuellenbrille, seine zynischen und sarkastischen Sprüche, sein ausgeprägter Unordnungssinn, sein permanentes Zuspätkommen und sein allzeit mangelnder Anstand haben ihn zum bei Lehrern wie Schülern gleichermassen bekannten Unikum gemacht. Dass sein Geist etwas voraus ist, muss er dadurch bezahlen, dass sein Körper ein wenig hintendrein ist. Trotz verzweifelter Versuche (siehe Foto) ist er seit 19 Jahren noch immer bartlos.
Was meine Psychiaterin trocken kommentierte: «Heute wären Sie nie ohne Diagnose durch die Schulzeit gekommen.»
Was wahrscheinlich stimmt. In der Tat waren die zuständigen Autoritäten immer alarmiert.
Bis zu meinem 20. Lebensjahr hörte ich von Lehrern, Rektorat und später dem Aushebungsoffizier den Satz: «Wenn alle so wären wie Sie, Seibt!» (Ein Satz, der mich jedes Mal ins Träumen versetzte: Was für eine erfreuliche Welt wäre das gewesen!)
Von 22 bis 25 gab es eine Zeit, in der ich am Flughafen, bei Polizeikontrollen und an der Kasse im Supermarkt regelmässig durchsucht wurde. Der Generalverdacht endete so mysteriös abrupt, wie er begonnen hatte.
Und immer wieder gab es Szenen wie die mit einer Psychologiestudentin auf einer Party. Wir sprachen erst ein paar Minuten, als sie sagte:
«Du hast so einen komischen Akzent. Woher kommst du?»
«Meine Eltern haben mich in die Schweiz importiert, als ich zwei war.»
«Vor zwei Jahren?»
«Nein, mit zwei.»
«Du bist hier, seitdem du zwei bist, und hast immer noch diesen Akzent?»
Ich lächelte. «Mir ist nie klar geworden, ob es Staubsuuger oder Stuubsauger heisst.»
Die Psychologiestudentin zuckte zusammen, als hätte man ihr eine Schlange unter die Nase gehalten.
Dann sagte sie: «So etwas Asoziales wie dich habe ich noch nie gesehen!», stand auf und ging. Es war ihr offensichtlich ernst. Ich sah sie nie wieder.
Ich blieb zurück, halb irritiert, halb geschmeichelt. (Immerhin war «das Asozialste, was ich je gesehen habe» eindeutig ein Superlativ.)
Zum grössten Teil verblüffte mich das Aufsehen, das ich machte. Unordnung, Unpünktlichkeit, kurz: die Widerspenstigkeit der Dinge erschien mir nicht als weiter bemerkenswert – sondern als etwas, was jeder Lady, jedem Gentleman passieren konnte.
So fand ich es leicht übertrieben, dass meine Mitbewohner in der WG für Gäste Führungen durch mein Zimmer machten. Die Hauptattraktion war neben dem sonstigen Chaos ein Würfel von rund einem Meter Kantenlänge aus leer getrunkenen Eistee-Packungen.
Ich hielt den Würfel für eine vor allem pragmatische Sache – es war Zeitverschwendung, beim Lesen oder Tippen den Eistee-Karton in der Küche zu entsorgen. So wie Ordnung überhaupt wenig Sinn ergab. Denn genau bedacht gab es nur zwei Möglichkeiten:
a) Ich war glücklich. Was ging mich dann das Chaos in meinem Zimmer an?
b) Ich war nicht glücklich – dann würde mir auch ein sauberer Parkettboden nicht helfen.
In der Tat bedauerte ich alle Kollegen, die Möbel aus Katalogen anschafften, mehrstöckige Menüs kochten oder Ehrgeiz in ihre Plattensammlung steckten – sie verschwendeten ihr Leben.
Deshalb:
Freiheit und Ignoranz
In der ersten «Sherlock Holmes»-Erzählung «Eine Studie in Scharlachrot» zieht Dr. Watson in die Baker Street. Und stellt durch Zufall fest, dass sein Mitbewohner keine Ahnung hat, dass sich die Erde um die Sonne dreht.
Irritiert macht er eine Liste zu der wilden Mischung an Kenntnissen und Unkenntnissen des neuen Mitbewohners.
Literatur: null.
Philosophie: null.
Astronomie: null.
Politik: mangelhaft.
Chemie: umfassende Kenntnisse.
Botanik: unterschiedlich – detailliertes Wissen über exotische Pflanzengifte, aber keine Ahnung vom praktischen Gärtnern.
Geologie: Unterscheidet auf den ersten Blick alle Erd- und Gesteinsarten in London und Umgebung. An der Theorie völlig desinteressiert.
Sensationsgeschichten: Scheint bis in jede Einzelheit sämtliche Gräueltaten zu kennen, die im letzten Jahrhundert verübt worden sind.
Und so weiter.
Als Watson Holmes vorwirft, ein Gentleman des 19. Jahrhunderts müsse doch wissen, dass sich die Erde um die Sonne dreht, kontert Holmes: Das menschliche Gehirn habe wie ein Dachboden nur beschränkte Kapazität. Und fügt hinzu: «Nur ein Idiot füllt seinen Kopf mit dem erstbesten Krempel.»
Ich war entschieden auf der Seite von Holmes – nur aus einem anderen Motiv. Für mich war gezielte Ignoranz die Grundlage der Freiheit. Meine Kenntnisse waren:
Essen und Trinken: null.
Mode: null.
Musik: null. (Das erste Mal hatte ich mit 16 freiwillig Musik gehört – eine «Beatles»-Kassette.)
Architektur: null.
Wirtschaft: null.
Geografie: null.
Dafür hatte ich, was fürs Schreiben nötig war: auf ziemlich allen anderen Gebieten eine streberhafte Allgemeinbildung, mit der ich jedes Fernsehquiz gewonnen hätte. Und in der deutschen Literatur war ich bewandert wie ein Bernhardiner in den Alpen.
Ich fand das eine strategisch brillante Entscheidung. Denn das Ergebnis gezielter Ignoranz war Freiheit. Ich musste mich nicht um modische Kleidung, gutes Essen oder guten Wein kümmern – etwas, was viele Leute unnötig Zeit und Geld kostete.
Und Gehirn. War man etwa mit zwei Weinkennern in einem Restaurant, verschwendeten sie endlos Zeit damit, über Wein zu reden. Was etwa so faszinierend war wie mit einem frisch verliebten Paar auszugehen, das sich die ganze Zeit küsste.
Die vielleicht klügste Entscheidung war der komplette Verzicht auf Musikwissen. Denn Musikgeschmack war das Unterdrückungsinstrument an sich. Irgendwelche Polizisten beurteilten einen andauernd: Hörte man das gerade Angesagte – oder war man pfui bäh bäh.
Zu antworten, dass man nicht einmal wisse, dass diese oder jene wichtige Band überhaupt existierte, war das perfekte Jiu-Jitsu.
Und – wie ich merkte – untergrub Kennerschaft den Genuss: Je mehr ich etwa über das Schreiben verstand, desto weniger Spass machte es. Bei miesem Stil meldete sich sofort der innere Scharfrichter: Ich hielt auch den Autor für einen verdorbenen Menschen. Meist zwar mich selber. Aber auch alle andern. Bis heute habe ich mich nie in eine Frau verliebt, die schlecht schrieb.
Gut, wenn man die Pest der Kompetenz so weit wie möglich begrenzte.
Dschungel
Nach der Diagnose fanden sich die Indizien überall: Chaos, verzögerte körperliche Entwicklung, der Verdacht der Umgebung, die Unfähigkeit zur Konzentration auf irgendetwas ausserhalb des eigenen Interesses, die gestörte Einfühlung in nicht verwandte Leute – alles war klassisch: ADHS.
Sogar scheinbar unverdächtige Dinge standen in Fachbüchern als Symptome: etwa die Vorliebe für Rückenkraulen. (Wäre ich reich, hätte ich einen Butler, einen Ghostwriter, einen Anwalt und einen Mann, der mir den Rücken krault.) Angeblich ist gerne gekrault werden ebenfalls typisch für ADHS.
Leicht enttäuschend ist, dass Dinge, die man für eine sehr persönliche Entscheidung hielt, plötzlich zur Normalvariante werden. So beendete ich etwa mein Studium drei Monate vor Schluss. Ich schrieb zwar die Lizenziatsarbeit (mit Bestnote), machte aber nie die Prüfungen. Ich dachte, ich tat das, weil ich gelernt hatte, was ich zu lernen hatte. Und weil jemand mir als Kind eine indische Legende vorgelesen hatte:
Ein Maharadscha hört von einem weisen Guru und wird eifersüchtig. Er lässt ihn verhaften, in die hinterste aller Zellen werfen und sagt: «Ich will sehen, ob die Leute recht haben, wenn sie dich den freiesten aller Menschen nennen. Die Tür hier ist mit Wachs versiegelt – du kannst jederzeit gehen. Aber wenn du es schaffst, zwanzig Jahre auszuhalten, dann will ich dir mein halbes Königreich geben.» Der Guru nickt und setzt sich – die Jahre vergehen, der Guru sitzt unbeweglich da, und schliesslich sind die zwanzig Jahre fast um. Dann, am letzten Tag, eine Stunde vor Ablauf der Frist, steht der Guru auf, öffnet die Tür und geht.
Wenn man mich fragt, warum ich das Studium nicht abgeschlossen habe, sage ich: Weil ich einmal im Leben auch so etwas tun wollte.
Die Statistik sagt weit Banaleres: Dass jemand mit ADHS sein Studium abbricht, ist die Norm.
Dazu gehört das «Konzept der unabgeschlossenen Handlung» generell zur Störung: Man geht etwa zum Kühlschrank, um Milch zu holen, denkt an etwas anderes und verlässt die Küche ohne die Milch und ohne die Kühlschranktür zu schliessen.
Kurz: Wirklich originell wäre in meinem Fall der ordnungsgemässe Abschluss gewesen.
Entdeckungen
Zum Teil entdeckt man nach der Diagnose nicht nur das Muster im Bekannten, sondern durch das Muster Neues. So etwa wurde mir, als ich über Entlassungen und ADHS gelesen hatte, klar, dass ich bis zu meinem 30. Geburtstag ausnahmslos in jedem Job gefeuert worden war.
Dabei waren die Storys völlig unterschiedlich. Hier nur drei:
Als ich Deutschlehrer in der Berlitz-Schule war, verliebte sich die Tochter der Chefin in mich. Sie war 19, ich 23. Ich konnte jeden Satz von ihr fertigdenken. Kein Wunder, ich hatte vier Jahre Vorsprung. Sie war klug, wild und schön, aber es erschien mir nicht richtig, mit ihr etwas anzufangen. Sie legte mir Briefe ins Fach, in denen etwa stand: «Beware of explosions!» Ich versuchte, ihr aus dem Weg zu gehen. Und kam zu oft zu spät.
In meinem Job als Handgepäckwagen-Stosser am Flughafen schrieb ein Kollege nach einem üblen Tag «Scheisssystem!» an die Wandtafel. Ich sah das, lachte, sagte: «So versteht unser Chef das nicht», und schrieb darunter «Scheisesystem» und «Swulsystem!». Am nächsten Tag liess mich der Chef ins Büro rufen. Ich entschuldigte mich: «Scheise und swul zu schreiben, war pubertär, es tut mir leid.» Worauf der Chef mich mit den Worten entliess: «Wenn du Scheise schribe – kei Problem! Wenn du swul schribe – kei Problem! Wenn du aber System schribe – nimme guet!»
Beim NZZ-«Folio» schrieb ich eine Literaturfälschungs-Kolumne. (Die bürgerlichstmögliche Form von Anarchie.) Nur hatte der damalige Chef des NZZ-Feuilletons, Martin Meyer, einen Hass aufs «Folio», weil niemand aus dem Feuilleton dort schreiben durfte, weil: zu verschwurbelt. Und schickte, wie man mir später erzählte, meine Artikel in der WOZ an die Chefredaktion – wobei er alle aufrührerischen Sätze wie etwa «Dass Banken mies sind, wusste man – dass sie dumm sind, ist eine echte Neuigkeit» farbig unterstrich. Schliesslich musste das «Folio» mich fallen lassen.
Immerhin wurde ich sowohl bei Berlitz wie auch beim «Folio» von der jeweiligen Chefin mit Champagner, einem Essen und einer Umarmung gefeuert. (Und im «Folio» schrieb ich danach unter Pseudonym.) Ich habe meine Entlassungen in herzlichster Erinnerung.
Das Dilemma
Das zeigt das Dilemma. So ziemlich jedes Symptom für ADHS ist längst zu einer Anekdote mutiert. Und damit der Analyse durch Einzigartigkeit entzogen. Bei dem meisten Unfug habe ich eine blendende Erklärung, warum nicht ich ihn verursacht habe – sondern dass er einfach so passierte. Meistens wegen absurder Missverständnisse.
Der Mensch ist das Tier, das sich rechtfertigt. Andererseits: Die Häufung an absurden Missverständnissen ist verdächtig.
Das Problem nach der Diagnose ist: Die Analyse des eigenen Lebens wird zwar nüchterner, bleibt aber verblüffend platt. Man gibt dieses oder jenes Ereignis hinein – und als Ergebnis bekommt man immer dieselben vier Buchstaben: A, D, H, S.
Verdächtig viel passt ins Muster – von Rückenkraulen bis Promiskuität, vom herumirrenden Blick bis zum Studienabbruch. Nur gelegentlich gibt es echte Überraschungen. So etwa wunderte ich mich am Küchentisch über das H von ADHS: Stimmte hyperaktiv? Ich war ein ruhiger Mensch ohne auffällige Gesten.
Worauf die Frau auf der anderen Tischseite nur lachte. Und mir das Youtube-Video eines eigentlich sehr harmlosen Interviews mit mir vorspielte: Und, Teufel, alle Enden von mir wippten herum, als wäre mein gesamter Körper aus nervösen Katzenschwänzen gefertigt.
Fünfzig Jahre lang hatte ich mich für einen guten Pokerspieler gehalten.
Doch auch das führt auf schnellstem Weg wieder zum Vierbuchstabenwort: Denn Menschen mit ADHS haben typischerweise eine schlechte Selbstkenntnis.
Kurz: Bingo. Nur was kann man damit anfangen? Die erste Erkenntnis ist die peinlichste. Dass es ziemlich wenig bringt, zu sagen: Das bin nicht ich, der dich verletzt, verblüfft, befremdet – das ist nur das verfluchte ADHS. Denn die Definition von Charakter ist ja geradezu: das, was von Geburt an unveränderlich ist.
In der Tat ist es fast unmöglich, sich vorzustellen, wer man ohne wäre: Als Störung in den Exekutivfunktionen sitzt ADHS zu tief im Gehirn. Und damit in der Biografie: in Strategien, Entscheidungen, Erlebnissen. Ich vermute, ohne wäre ich ein eher kühler, ziemlich strategischer Kopf. Aber weiss der Teufel, was ich damit anfangen würde.
Wahrscheinlich bleibt von der Diagnose nicht viel mehr Nutzen als ein paar präzisere Strategien. Kennt man beispielsweise den Mechanismus der unabgeschlossenen Handlung, kann man sich mahnen: «Jetzt keine unabgeschlossene Handlung, Freundchen!» Und man schliesst die verdammte Kühlschranktür.
Persönlich bleibt die Lage die gleiche: Schön, wenn du über dich nachdenkst. Aber es ist eine grosse Sünde, an die eigene Propaganda zu glauben. Glaube also nicht deinen Anekdoten, die das Leben überzogen haben wie die Muscheln einen alten Schiffsrumpf. Und glaube nicht, dass alles, was du machst, denkst oder fühlst, aus vier Buchstaben besteht.
Wahrscheinlich steht es mit ADHS so wie mit fast allem, etwa dem Coronavirus:
Mein Grossonkel, ein österreichischer Landarzt, behandelte einmal einen Bauern, der Masern hatte. «Was soll ich tun?», fragte der Bauer. Worauf mein Grossonkel sagte: «Seien Sie glücklich. Denn wenn Sie nicht glücklich sind, werden Sie auch Masern haben.»
Illustration: Alex Solman