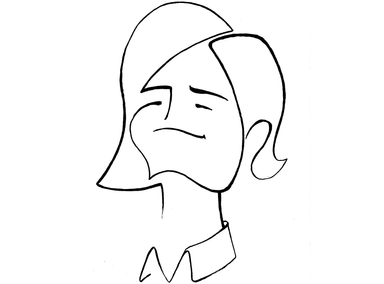
Das Recht auf Überleben
Patientenverfügungen von Alten und Kranken mit erhöhtem Covid-19-Sterberisiko sollen Intensivbetten frei machen. Das hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Wir stehen vor einer Prüfung, an der wir nicht scheitern dürfen.
Von Daniel Binswanger, 04.04.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Es ist der Moment, dringend wieder Immanuel Kant zu lesen. Zum Beispiel die Definition des kategorischen Imperativs in der «Grundlegung zur Metaphysik der Sitten»: «Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst.» Jeder Mensch hat seinen Existenzzweck in sich selber und ist als menschliches Wesen, das nur für sich selber steht, zu achten und zu schützen.
Oder: Falls Ihnen das zu abstrakt ist, lesen Sie einfach die Genesis: «Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn.» Oder wenn Ihnen das zu fromm ist, dann lesen Sie Artikel 7 der Schweizer Verfassung: «Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.» Und wenn Ihnen das zu nüchtern helvetisch ist, dann meditieren Sie über die machtvolle Formulierung im deutschen Grundgesetz: «Die Würde des Menschen ist unantastbar.»
Die Würde des Menschen ist das absolute Fundament unserer Wertegemeinschaft – eigentlich ist das ja eine fürchterliche Banalität. Aber es ist der Moment, uns dieses Fundament in Erinnerung zu rufen, mit Insistenz, mit Penetranz, mit beinharter Kompromisslosigkeit. Denn die Covid-Krise bringt nicht nur die Gesundheitssysteme an den Rand und dürfte zur grössten Herausforderung der Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg werden. Sie unterzieht auch unsere Wertebindungen einer existenziellen Prüfung – einer Prüfung, an der wir nicht scheitern dürfen. Nichts könnte wichtiger sein, als dass wir immun bleiben gegen jede Versuchung, von unserem ethischen Fundament auch nur einen Millimeter preiszugeben. Und nichts dürfte anspruchsvoller sein.
Es ist mit den Grundwerten so eine Sache: Zum einen haben sie einen absoluten Geltungsanspruch, zum anderen gibt es leider nichts auf dieser Erde, was bis zu einem bestimmten Grad nicht doch verhandelbar wäre. So ist es etwa einer der Widersprüche der heutigen Gesellschaft, dass ihre Ordnung auf Grund- und Menschenrechten beruht, die eine Schutz- und Fürsorgepflicht für alle Menschen gebieten, dass sie ihre Wohlfahrt aber einem Wirtschaftssystem verdankt, das nicht die Fürsorge, sondern die Konkurrenz zu ihrem obersten Prinzip erhebt. Natürlich lässt sich dieser Widerspruch in normalen Zeiten recht weitgehend entschärfen: Arbeitnehmer werden dazu eingestellt, auf dem freien Markt Gewinn zu erzielen – aber sie können auch darauf zählen (in aller Regel), dass ihnen anständige Löhne, arbeitsrechtlicher Schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet wird. Heute aber leben wir nicht in normalen Zeiten.
Die Diskussion, wann die Wirtschaftsaktivität wieder hochgefahren werden muss und wie viele Corona-Tote dafür als Opfer akzeptabel sind, ist bereits in vollem Gang. Es ist unvermeidbar, dass diese Abwägung früher oder später getroffen wird: Irgendwann, irgendwie wird das Leben weitergehen müssen. Aber es ist abzusehen, dass der ökonomische Realismus auf brutale Weise mit der Fürsorgepflicht kollidiert.
Werden wir bis zuletzt die Würde des Menschen – aller Menschen, auch der Alten, der Gebrechlichen, jener mit Vorerkrankungen – unantastbar lassen? Werden wir sie konsequent und mit allen Mitteln schützen?
In der Schweiz jedenfalls hat diese Woche ein Thema die Debatte dominiert, das einen mehr als schalen Nachgeschmack hinterlässt: die Patientenverfügung. Auf allen Kanälen sind plötzlich Ethiker und Palliativmediziner durch die Medien paradiert, um eine wichtige Botschaft unters Volk zu bringen: Ganz vordringlich sei es nun, dass alle betagten Mitbürger per Verfügung festlegen, ob sie im Fall einer Infektion lebensverlängernde Massnahmen für sich in Anspruch nehmen wollen oder nicht.
Möchten sie, wenn es zum Äussersten kommen sollte, hospitalisiert werden? Wären sie gewillt, Intensivpflege auf sich zu nehmen und an ein Beatmungsgerät gehängt zu werden? Oder würden sie es stattdessen vorziehen, zu Hause oder im Altersheim zu bleiben und unterstützt von Schmerzmitteln, Psychopharmaka und progressiv erhöhten Morphiumdosen einen einigermassen schmerzfreien Tod zu sterben?
Mehrere Kantone, darunter auch der Kanton Zürich, haben Weisung gegeben, dass in allen Alters- und Pflegeheimen mit den Bewohnerinnen das Gespräch gesucht werden muss, um eine Patientenverfügung zu erwirken. Auch die Spitex ist aktiv. Von Amts wegen: Senioren sollen neuerdings ihren Lebenswillen schriftlich geben.
Entscheide zwischen belastenden, lebensverlängernden Massnahmen und zurückhaltender Sterbebegleitung sind ein extrem anspruchsvolles Feld der Abwägung. Nichts wäre verfehlter, als vom hohen Ross ethischer Grundsätze herunter die sich stellenden Fragen vorschnell beantworten zu wollen. Ärztliche Erfahrung und eine konkrete Vertrautheit mit dem jeweiligen Einzelfall sind dafür unverzichtbar. Ausser Frage steht, dass es in vielen Fällen die humanere Lösung sein dürfte, wenn eine hochbetagte Patientin sich nicht beatmen lassen will. Ausser Frage steht ebenfalls, dass die Betroffenen – und solange sie urteilsfähig sind, nur die Betroffenen – diesen Entscheid zu fällen haben. Dennoch: Es bleibt ein schaler Nachgeschmack.
Offensichtlich ist es nicht so, dass der Aktivismus jetzt ausgebrochen ist, weil die Gesundheitsbehörden sich auf einmal an die Wichtigkeit des selbstbestimmten Sterbens erinnern würden. Patientenverfügungen sind auch in Nichtkrisenzeiten eine gute Sache. Aber sie werden heute kaum deshalb eingeholt, weil man sich ganz plötzlich davor fürchtet, dass man dem Willen der Patientinnen zuwiderhandeln könnte. Sie werden eingeholt, weil man von möglichst vielen Senioren eine Erklärung zum Verzicht auf Intensivbehandlung möchte.
Da weiterhin akute Gefahr besteht, dass die Fallzahlen die oberste Grenze der Schweizer Intensivbetten-Kapazität überschreiten werden, forciert man mit den Patientenverfügungen das denkbar billigste und effizienteste Mittel der Entlastung. Der Median des Alters der Corona-Todesfälle in der Schweiz liegt gemäss Bundesamt für Gesundheit bei 82,5 Jahren. Wenn man einen substanziellen Teil der Hochbetagten dazu bringen könnte, Intensivpflege gar nicht erst in Anspruch zu nehmen, würde das zu einem enormen Belastungsrückgang in den Spitälern führen. Das ist offensichtlich der Plan.
Er wirft unschöne Fragen auf. Ist es unter diesen Voraussetzungen noch glaubhaft, dass das Interesse der Patientinnen und Patienten der strikte und alleinige Leitgedanke des ärztlichen Handelns darstellt? Dass die Patientinnen, um mit Kant zu reden, als Zweck an sich behandelt werden und nicht als Mittel, um das Betreuungssystem zu entlasten? Wie wird – da es unter den gesundheitspolitischen Entscheidungsträgern einen Konsens zu geben scheint, dass Intensivbehandlung bei Patientinnen jenseits der 80 gar nicht unbedingt angezeigt ist – der Umgang mit solchen Fällen in Schweizer Spitälern aktuell gehandhabt? Auch dann, wenn keine Patientenverfügung vorliegt? Auch heute, wo ausreichende Kapazitäten vorhanden sind?
Oberstes Ziel der Schweizer Gesundheitsbehörden muss es sein, die Intensivbetten-Kapazität so weit hochzufahren wie irgend möglich – auch wenn das enorme Kosten und extremen Aufwand bedeutet. Oberstes Ziel muss es sein, den Schutz von allen Mitgliedern der Gemeinschaft zu gewährleisten, der Alten, der Schwachen, der Vorerkrankten. Alle anderen Massnahmen sind erst danach zu ergreifen – erst dann, wenn sie unvermeidlich werden. Wenn Patientenverfügungen zur Vorabtriage verkommen, sind sie ethisch nicht vertretbar.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auch für Opa.
Illustration: Alex Solman