
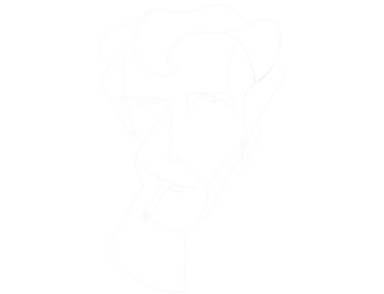
Der, der du niemals sein wirst
Nebenwirkungen
Die ADHS-Kolumne, Folge 5 – Wirklich gefährlich werden Psychopharmaka, wenn du ihretwegen seriöser wirst.
Von Constantin Seibt, 26.03.2020
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
«Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht.»
Georg Christoph Lichtenberg
Zunächst fühlten sich Diagnose plus die Psychopharmaka eher harmlos an – irgendwo zwischen interessant und pragmatisch.
Etwa so, als spielte man Tennis mit schärferer Brille. Plötzlich sieht man die Linien klarer und die Bälle früher. Was angenehm ist, weil man ohne Aufwand ein besserer Spieler wird.
Der Haken an der Brille kommt erst später. Und er ist ebenso überraschend wie logisch: Du siehst schärfer.
Denn sobald sich der träumerische Nebel etwas verzieht, sobald du organisierter, damit handlungsfähiger bist, merkst du, dass deine nähere Umgebung dich irritierend oft wie einen Dreijährigen behandelt.
Das deshalb, weil sie teilweise zu vergessen scheint, dass du verstehst, was gesagt wird. Sodass gleichzeitig mit dir und über dich verhandelt wird: «Kannst du das?», «Glaubst du wirklich, dass du das kannst?», «Der kann das doch nicht!», «Also, du lieferst bis fünf Uhr und keine Minute später!», «Du weisst, dass das wichtig ist, oder?», «Du wirst das nicht vergessen, oder?».
Und falls man es doch geschafft hat: «Also ich hätte nicht erwartet, dass du das hinkriegst.» Et cetera, et cetera, et cetera.
Es ist, als würden sich Kollegen, Partnerinnen, Freunde periodisch in Eltern verwandeln. Sobald das Gemurmel der eigenen Ideen schweigt, hörst du die Witze, die Seufzer, die Zweifel, die Urteile und den Kommandoton.
Zugegeben: Vielleicht hörst du es ein wenig zu laut, weil es dir nun auffällt. Trotzdem fragst du dich, wie zum Henker du diesen Trashtalk so viele Jahre überhören konntest.
Die Antwort ist (zumindest in meinem Fall): aus Gründen.
Strategie
Fast fünfzig Jahre lang fuhr ich eine sehr einfache, kaltblütige Strategie. Ich wusste, dass die Leute Witze machten: über meinen Gang, meine Zuverlässigkeit, meine Art zu verschwinden oder zu reden. Ich wusste, dass viele seriöse Leute sich mir weit überlegen fühlten. Und von Zeit zu Zeit konnte ich nicht ganz ignorieren, dass viele Leute vor mir warnten.
So etwa wurden bei den zwei wichtigsten Anstellungen meines Lebens Protestschreiben verfasst. Bei der WOZ verlangte ein Rundschreiben an meinem ersten Arbeitstag meine sofortige Wiederentfernung, da ich ein Sicherheitsrisiko für das Erscheinen der Zeitung sei – und ausserdem «ein kleinbürgerlich-anarchistischer Feuilletonist».
Später, beim «Tages-Anzeiger», unterschrieb über ein Drittel der Redaktion den Protestbrief. (Es kursierten Gerüchte, dass ich zum Tagi komme, um später ein vernichtendes Buch über die Zeitung zu schreiben.)
Beides verblüffte mich eher, als dass es mich besorgte. Der kindliche Teil von mir fühlte sich sogar geschmeichelt: Jemand hält dich für gefährlich, cool! Der erwachsene Teil dachte eigentlich nur: «Sie irren sich.» Und dass ich immerhin ein paar alte Kollegen von früher als Verbündete hatte.
Nun, viele Jahre später hörte ich, dass es die Kollegen von früher gewesen waren, die am überzeugendsten vor mir gewarnt hatten. Und dass in meiner alten Zeitung Wetten liefen, dass ich spätestens nach drei Monaten gefeuert werden würde.
Kein Wunder, erwartete mich ein hartes erstes Jahr. Doch vom ersten Tag an verhielt sich die Redaktion des «Tages-Anzeigers» tadellos – keine Fallen, keine Intrigen, keine Pfeile in den Rücken. Nach einem halben Jahr war ich an Bord, und ein paar Kollegen gratulierten mir zu meinen Nerven aus Stahl.
In Wahrheit schützen mich wahrscheinlich weniger meine Nerven als meine Blindheit.
Im Gymnasium hatte sich zu meiner Überraschung mein Banknachbar von mir weggesetzt, ein konservativer Bauernsohn, den ich trotz aller gegenseitigen Polemik sehr mochte. Ich wurde neben eine der zwei Klassenfeministinnen gesetzt, sie hatte ihre Banknachbarin mehrfach zu Tränen getrieben.
Am Tag vor den Sommerferien sagte die Feministin: «Ich hab dich immer für ein Arschloch gehalten. Aber du hast nie zurückgefeuert, obwohl ich dir jeden Tag die übelsten Gemeinheiten gesagt habe. Dafür hast du meinen Respekt.» Ich freute mich, weil ich sie mochte, dachte aber: «Gemeinheiten? Jeden Tag? Was für Gemeinheiten?» Ich hatte nichts bemerkt.
Bis rund fünfzig sagte ich mir, dass Spott und Missverständnisse der Preis waren, den meine Freiheit kostete. Egal, was irgendwer sagte, ich würde einfach mein Ding machen. Und eines Tages damit durchkommen.
Schon weil meine Gegner nicht einmal eine Ahnung hatten, in welchem Spiel sie spielten. Sie befolgten die Regeln, um beweisbar solide Arbeit zu leisten. Ein gutes Rezept für fast alles im Leben, aber ein schwerer Fehler in der Aufmerksamkeitsökonomie.
Viel Arbeitszeit verbrachte ich, mir hinter einer Zigarette zu überlegen, was die Regeln eines sauberen, gepflegten Journalismus waren. Und wie man sie systematisch brechen konnte. Zu Beginn tat ich das aus Spieltrieb. Später auch aus ernsthaften Gründen.
Denn Journalismus ist nicht nur die Waffe, sondern auch die Waffel der Aufklärung. Kaum jemand setzt sich am Morgen hin und liest aus Pflichtgefühl. Sondern aus Langeweile, Neugier, Vergnügen, Sehnsucht oder Weltflucht.
Deshalb ist der Realismus selbst in der seriösesten Presse verzerrt – denn was das Publikumsinteresse angeht, schlägt die Ausnahme stets die Regel. «Hund beisst Mann» ist keine Nachricht, «Mann beisst Hund» schon. Der Gang der Welt ist nichts gegen den Weltuntergang. Was heisst: Grosse Teile der Wirklichkeit bleiben unsichtbar, weil sie als zu komplex oder zu banal gelten.
Was wiederum heisst: Wer ernsthaft über ernsthafte Dinge schreiben will, muss sich einiges einfallen lassen, um das Gewohnte wieder ungewohnt zu machen.
Baut man Witze ein, erzählt man Geschichten, verblüfft man durch Paradoxe (oder durch Pathos), kann man es sich leisten, über die Zusammenhänge in Politik und Wirtschaft zu schreiben, ohne dass das Publikum den Artikel respektvoll überspringt.
Im Journalismus wie im Leben muss man sich entscheiden: Seriös aussehen oder seriös sein? (Wobei Ersteres oft lukrativer, Zweiteres dafür interessanter ist.)
Trade off
Die Pointe bei jeder psychischen Störung ist, dass sie einen ausserhalb der Normalität versetzt – und doch nicht. Egal, womit man geschlagen ist, ob ADHS, Depression, Narzissmus, bipolare Störung oder weiss der Henker – der Unterschied zur Normalität besteht immer nur in der Dosis.
Der Rest der Menschheit fühlt dasselbe, nur kontrollierter: als Nervosität, Traurigkeit, Ehrgeiz, Religion oder Gott weiss was. Kein Abgrund, von dem nicht zumindest die Ahnung in jedem Herzen wohnt.
Das heisst: Vertrau der Welt, dass sie dich hört. Auch wenn du glaubst, du bist fremd – du bist es nicht.
Jedes Individuum sieht einige Dinge verzerrter, andere präziser als die Mehrheit. Der Vorteil etwa von ADHS ist, dass ein Gehirn mit Mangel an Dopamin sich enorm schnell langweilt – und dass Langeweile das eigene System so gründlich lahmlegt, dass die Besitzerinnen eines derartigen Gehirns sie mehr fürchten als den Teufel persönlich.
Das kostet zwar pro Jahr etwa mehrere tausend Franken – wenig ist in der Schweiz teurer als das Nichtausfüllen von Formularen (Spesenrechnung, Krankenkassensubventionen, Steuererklärung etc.). Aber für einen Job in der Informationsbranche ist körperliche Furcht vor Langeweile unschätzbar wertvoll.
Das, weil Leserinnen Kinder wie du sind. (Wären sie nicht neugierig, würden sie nicht lesen.) Sie leiden zwar bei grauem Zeug nicht existenziell – sie dösen dann nur. Aber sind genau so glücklich, wenn zwischen Informationen ein Stück Konfekt, ein Stück Fleisch, ein Zusammenhang oder eine Idee auftaucht.
Fluch und Gabe bei ADHS ist der unerbittliche Filter für Aufrichtigkeit. Man bringt nur zu Ende, was einen begeistert. Den Rest vermurkst man. Will man in egal welchem Job überleben, bleibt einem so nichts übrig, als dem eigenen Herzen zu folgen.
Und das ist auch das wesentliche Rezept im Journalismus: Ein Profi recherchiert immer in zwei Richtungen. Nach aussen, was die Fakten sind. Und dann nach innen, ins eigene Herz, was diese Fakten bedeuten.
Denn damit es irgendwen in der Welt etwas angeht, muss es zuerst dich etwas angehen.
Die Aufmerksamkeitsbranche ist eine brutale Industrie. Fleissige, berechenbare, solide Leute werden weder gesehen noch belohnt. Sondern nur die, die die Show schmeissen.
In dieser Branche gilt streng der Aphorismus des indischen Dichters Rabindranath Tagore: «Gott achtet mich, wenn ich arbeite, aber Gott liebt mich, wenn ich singe.»
Was, wie ich weiss, brutal ungerecht ist. Und deshalb hatte ich in meinen fünfundzwanzig Berufsjahren immer ein doppeltes Gefühl:
Zum Ersten verstand ich alle, die mich hassten, verachteten oder fürchteten. Sie hatten meine aufrichtige Sympathie. Es ist bitter, wenn man verlässlich arbeitet, ohne geliebt zu werden.
Was ich dagegen nicht verstand, war, dass sie die Regeln des eigenen Jobs nicht verstanden: dass man diesen Beruf nur dann korrekt machen kann, wenn man die Regeln regelmässig bricht.
Ich glaube heute, die Strategie meiner ersten fünfzig Jahre war zwar skrupellos, aber die richtige: Ich setzte auf das, was ich konnte – und ignorierte mit einem freundlichen Fuck you den Rest.
Der Preis, den ich zahlte, war, dass fünfzig Jahre nur wenige merkten, wann ich es ernst meinte.
Dilemma
Aber dann machte ich mit diesem Spiel Schluss.
Warum? 1. Es langweilte mich. 2. Übermut. 3. Eine neue Rolle.
Als wir die Republik planten, war mir klar, dass meine bisherigen Tricks nicht ausreichen würden. Du kannst nur dann etwas bauen, wenn man auf dich bauen kann.
Ich brauchte eine Strategie. Also fing ich an heranzuziehen, was mir nützlich erschien. Die ADHS-Diagnose, die Psychopharmaka und die plötzliche Faszination für liberale Werte – für Verantwortung, Institutionen und ökonomisches Denken: dass man für jede Entscheidung einen Preis zahlte.
Und mit der Unternehmensgründung wurde der Preis für viele meiner Gewohnheiten zu hoch. Unpünktlichkeit etwa: Ich verstand plötzlich, dass ich beim Zuspätkommen die Zeit anderer verschwendete – und dass sich die Verspätung bei eng getakteten Sitzungen oder in einer Produktionskette in Kaskaden fortsetzte.
Oder die Toleranz gegenüber zweifelhaften Ideen: Sobald sich die Sache nicht mehr im Kopf, sondern im Unternehmen abspielte, stahl jede laufen gelassene Idee den Raum und die Zeit jeder anderen.
Oder Charme: Warum etwas vergeigt wurde, war plötzlich egal – es war vergeigt. Punkt. Auch wenn die Erklärung dafür charmant war.
Ich weiss nicht, ob es das ADHS-Medikament war. Oder die Entschlossenheit, die Haltung zu ändern: Jedenfalls machte ich schnell Fortschritte. Ich wurde pünktlicher, verlässlicher, effizienter.
Zugegeben, von niedrigem Niveau aus. Aber es war cool. Und ich war sehr glücklich. Und sehr überzeugt, dass nun mit der Schlenderei so gut wie Schluss war, bis …
… nun, drei Dinge passierten:
Je disziplinierter du wirst, desto weniger Humor hast du für die Undiszipliniertheit anderer übrig. Blödheit, Unzuverlässigkeit, Sprunghaftigkeit verlieren ihren anarchistischen Zauber – sie sind nur noch eine Störung. Brecht schrieb nicht ohne Grund: «Der schlimmste Feind des wilden Elefanten ist der gezähmte Elefant.» Ich entdeckte verblüfft, wie weit weniger charmant ich charmante Menschen fand.
Die Leute gewöhnen sich sehr schnell an dein zuverlässigeres Ich. Und plötzlich sprechen die Zahlen gegen dich. Kommst du acht von zehn Mal zu spät, sind alle die zwei Mal, bei denen du pünktlich bist, überrascht und entzückt. Kommst du jedoch acht von zehn Mal pünktlich, bekommst du bei allen Verspätungen kalte Blicke.
Plötzlich macht es dir etwas aus, wenn du von egal wem als Kind behandelt wirst. Erstens, weil du es nicht mehr als gerecht empfindest. Zweitens, weil – seit dich nicht mehr die Beschreibung der Dinge, sondern ihre Erledigung interessiert – dein Blick für Fehler und Fuck-ups der anderen viel schärfer geworden ist.
In einem Satz: Ich hatte gleich zwei Mal die Welt gewechselt. Von der Welt der Beobachtung in die des Handelns. Und von der Welt des Singens in die des Arbeitens.
Die neue Welt war karger, erdiger und kälter – dafür völlig neu. Bloss die Ungerechtigkeit blieb dieselbe. Nur, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, unverdient begünstigt zu werden, sondern beurteilt.
Ich brauchte länger, bis mir klar wurde, dass das Problem meiner Unzuverlässigkeit sich trotz hartem Kampf in den Augen der anderen nicht gebessert hatte. Sondern verschärft.
Davor war ich unzuverlässig. Mit Ausnahme von zwei Dingen: Ich lieferte zuverlässig nachlässigen Charme und gute Texte. Punkt.
Nun brachte ich zwar ungleich mehr auf die Reihe. Nur konnte man sich nun nicht einmal mehr auf meine Unzuverlässigkeit verlassen.
Selbst wenn ich in meinen entschlossensten Zeiten sieben oder acht von zehn Mal pünktlich lieferte, konnte niemand vorhersagen, wann ich es doch nicht tun würde. Und als ich später im Strudel der Redaktionsgründung nicht mehr wie in den Jahren als Journalist etwa drei von vier wichtigen Versprechen hielt, sondern an einigen Tagen erstaunliche dreissig von vierzig, steigerte dies das Vertrauen keinesfalls: Davor hatte ich nur ein Versprechen vermasselt. Und jetzt zehn.
Auch der nachlässige Charme verschwand mit der Nachlässigkeit. Jetzt, da ich entschlossen war, alle Dinge zu erledigen, fand ich die Befürchtungen, Ermahnungen, Witze anderer Leute nicht mehr witzig.
Das alles war nicht lustig, zugegeben. Aber grossartig interessant. «Wow, so läuft das also», dachte ich oft. Und nicht zuletzt war ich überzeugt, das ganze Verantwortungsprojekt liesse sich nicht anders durchreissen als mit dem Draghi-Put: Ich werde das tun, whatever it takes!
Kurz: Ich wurde härter, erwachsener, entschlossener. Mir war klar: Gott liebte mich nicht mehr. Aber ich würde es ohne ihn schaffen.
Im Sommer nach dem Start der Republik sagte mein Bruder: «Du hast deinen Humor verloren.»
Und ich antwortete: «Gott sei Dank.»
Illustration: Alex Solman