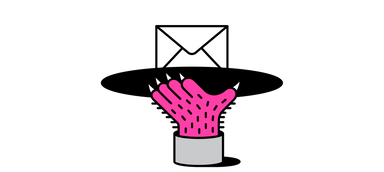
Kritik an Schweizer Corona-Strategie, «Like» als üble Nachrede – und Junge wollen die 2. Säule retten
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (90).
Von Philipp Albrecht, Elia Blülle, Bettina Hamilton-Irvine, Carlos Hanimann und Brigitte Hürlimann, 27.02.2020
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Das Coronavirus hat die Schweiz erreicht: Am Dienstag informierte das Bundesamt für Gesundheit, dass im Tessin ein 70-jähriger Mann vom Virus infiziert worden sei und es schweizweit mindestens 70 weitere Verdachtsfälle gebe.
Trotzdem wollen die Schweizer Behörden an der Risikoeinschätzung im Moment nichts ändern. Das Virus stelle für die Bevölkerung in der Schweiz zurzeit noch ein moderates Risiko dar, sagte der Direktor des Bundesamts für Gesundheit an der Pressekonferenz. Drastische Massnahmen will der Bund erst ergreifen, wenn es in der Schweiz zu Ansteckungen kommt, bei denen die Übertragungskette nicht mehr zurückverfolgt werden kann.
Nicht alle sind einverstanden mit dieser Einschätzung. Der Berner Epidemienforscher Christian Althaus übte in einem Interview mit der NZZ harsche Kritik an der Kommunikationsstrategie des Bundes. An den Pressekonferenzen der vergangenen Wochen seien viele Falschinformationen verbreitet worden. «Die Aussage, die Gefährlichkeit sei etwa so hoch wie bei einer saisonalen Grippe, ist absurd», sagt der Wissenschaftler. «Sie basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.»
Althaus spricht von einer der grössten gesundheitlichen Notlagen der jüngeren Schweizer Geschichte und rechnet im Worst-Case-Szenario mit 3 Millionen Infizierten. Es ergebe zwar keinen Sinn, Panik zu verbreiten, sagt er, aber die Bevölkerung müsse wissen, dass eine Epidemie auf die Schweiz zukommen werde. Angesichts der momentanen Bedrohungslage handelten die Behörden viel zu passiv. Althaus befürchtet, dass man akzeptiert habe, dass eine Ausbreitung nicht mehr zu stoppen sei. «Das wäre gefährlich.»
Sobald eine starke Gefährdung der öffentlichen Gesundheit droht, ist es die Aufgabe des Bundesrats, eine «besondere Lage» auszurufen und zum Beispiel Einrichtungen zu schliessen. Damit es nicht so weit kommt, schlägt Althaus vor, Patientinnen in Spitälern bestmöglich zu versorgen, alle Verdachtsfälle sauber zu überprüfen und beispielsweise Altersheime besonders zu schützen. Derweil hat das Bundesamt für Gesundheit eine Kampagne lanciert, um empfohlene Hygienemassnahmen in Erinnerung zu rufen.
Und damit zum Briefing aus Bern.
Asylverfahren: Bund soll Handys durchsuchen dürfen
Worum es geht: Der Bund soll künftig im Asylverfahren auf Handydaten und andere elektronische Geräte von Geflüchteten zugreifen können. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag erarbeitet.
Warum Sie das wissen müssen: Die Identität von Geflüchteten spielt in Asylverfahren eine entscheidende Rolle. In rund drei Vierteln der Fälle kann das Staatssekretariat für Migration (SEM) diese aber nicht von Anfang an zweifelsfrei feststellen. SVP-Nationalrat Gregor Rutz hat deshalb eine parlamentarische Initiative eingereicht, damit die Behörden elektronische Geräte nach Hinweisen auf die Identität der Asylsuchenden durchsuchen können. In Deutschland hat ein ähnliches Gesetz kaum nützliche Hinweise ergeben: Zwei Drittel der Durchsuchungen waren ergebnislos. In einem Schweizer Pilotprojekt wurden nur in 15 Prozent der 565 Fälle nützliche Hinweise gefunden. Trotzdem will nun eine Mehrheit der Kommission eine gesetzliche Grundlage für die Handyüberwachung schaffen: Die Asylsuchenden sollen Smartphones, Laptops, SIM-Karten, USB-Sticks und SD-Karten herausgeben müssen. Der Zugriff auf diese Daten ist ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre der Geflüchteten. Das SEM könnte gemäss dem jetzigen Vorentwurf nicht nur zur Prüfung eines Asylgesuchs auf die privaten Daten zugreifen, sondern auch zur Vorbereitung von Ausschaffungen.
Wie es weitergeht: Die Gesetzesänderung geht nun bis zum 4. Juni in die Vernehmlassung. Dort dürfte sie auf Kritik stossen: Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hat das Vorhaben bereits scharf kritisiert.
Rentenreform: Jungpolitiker machen eigenen Vorschlag
Worum es geht: Die berufliche Vorsorge benötigt dringend eine Reform. Sechs Jungparteien wollen nun die 2. Säule unter anderem mit einem flexiblen Rentenalter retten.
Warum Sie das wissen müssen: Das 3-Säulen-System der Schweizer Altersvorsorge ist veraltet. Das Geld wird knapp, weil wir immer älter werden und unser Erspartes seit einigen Jahren keine Zinsen mehr abwirft. Doch die Politik beisst sich an einer Reform die Zähne aus. Zuletzt scheiterte im September 2017 ein grosser Reformvorschlag des Bundesrats für die 1. und die 2. Säule an der Urne. Gesundheitsminister Alain Berset feilt seither an einer neuen Vorlage. Nun haben sich die Jungsektionen von SVP, FDP, CVP, BDP, GLP und EVP eingeschaltet. Sie fordern unter anderem:
ein flexibles Rentenalter, das an die Lebenserwartung gekoppelt wird und für Frauen und Männer gleich ist;
einen flexiblen Umwandlungssatz, der jährlich vom Bundesrat angepasst werden kann, und
ein Eintrittsalter von 18 statt 25 Jahren für die zweite Säule.
Die bisherigen Vorschläge des Bundesrats gehen nicht ganz so weit. So will Berset das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 Jahre erhöhen und den Umwandlungssatz, der die Höhe der Jahresrente bestimmt, von 6,8 auf 6 Prozent senken. Die Gewerkschaften wiederum wollen vor allem die AHV stärken, und die Juso fordern, dass auch Kapitaleinkommen AHV-pflichtig werden.
Wie es weitergeht: Die parlamentarische Debatte zum nächsten Anlauf hat noch nicht begonnen. Der Jungparteienvorschlag fliesst in die laufende Vernehmlassung ein. Sie basiert auf einem Kompromiss zwischen Gewerkschaften und dem Arbeitgeberverband, der auch dem Bundesrat gefällt.
Gesundheitskosten senken: Kommission gibt ihren Segen
Worum es geht: Die Gesundheitskommission des Nationalrats hat sich am vergangenen Freitag einstimmig für das erste von zwei Massnahmenpaketen ausgesprochen, die dafür sorgen sollen, dass die Gesundheitskosten nur in dem Umfang steigen, wie sie medizinisch begründbar sind.
Warum Sie das wissen müssen: Die beiden Massnahmenpakete des Bundesrats sind nur einer von diversen Ansätzen, um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen – wenn auch der umfassendste. Das erste Paket umfasst 9 Massnahmen, wie zum Beispiel die Einführung eines Experimentierartikels, der innovative und kostendämpfende Projekte ermöglichen soll. Die Massnahmen basieren auf einem Bericht einer internationalen Expertengruppe und sollen zu Einsparungen von jährlich mehreren hundert Millionen Franken führen. Das zweite Paket will vor allem definieren, wie sich die Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung entwickeln dürfen. Daneben sind mehrere Volksinitiativen zum Thema in der Pipeline. So fordert die CVP in ihrer Kostenbremsen-Initiative, dass die Prämien nicht stärker steigen dürfen als die Löhne. Die SP wiederum schlägt vor, dass die Prämienbelastung pro Haushalt nicht mehr als 10 Prozent des Einkommens betragen darf. Die radikalste Initiative stammt von Yvette Estermann: Die SVP-Nationalrätin will eine Krankenkasse «light» – und könnte sich sogar vorstellen, mit der Initiative den Weg zu ebnen, um den Versicherungszwang abzuschaffen.
Wie es weitergeht: Der Bundesrat plant, das zweite Paket mit kostendämpfenden Massnahmen im März in die Vernehmlassung zu schicken. Das erste Paket wird das Parlament an einer Sondersession am 4. und 5. Mai behandeln.
Bundesgericht: Ein «Like» kann üble Nachrede sein
Worum es geht: Wer auf Social Media durch Liken oder Teilen dazu beiträgt, einen ehrverletzenden Inhalt weiterzuverbreiten, kann sich der üblen Nachrede schuldig machen – genauso wie der Autor der Nachricht. Dies hat das Bundesgericht in einem Leiturteil festgehalten.
Warum Sie das wissen müssen: Liken und Sharen ist schnell gemacht: Oft werden die Knöpfe gedrückt, ohne gross darüber nachzudenken. Doch das höchste Gericht erinnert in seinem Entscheid an die Verantwortung der Nutzer. Strafbar wird das Liken oder Sharen dann, wenn die ehrverletzende Ursprungsnachricht dadurch von Dritten wahrgenommen wird. Das hängt gemäss Bundesgericht von der Pflege des Newsfeeds, vom Algorithmus des Netzwerkdienstes und von den persönlichen Einstellungen der Nutzer ab. Es ist jedoch davon auszugehen, dass gelikte oder geteilte Inhalte in aller Regel eine Weiterverbreitung an Dritte bedeuten: Der vom Autor der Nachricht ursprünglich anvisierte Empfängerkreis wird deutlich erweitert.
Wie es weitergeht: Das Zürcher Obergericht hatte dem Mann, der mehrfach auf Facebook ehrverletzende Beiträge gelikt und geteilt hatte, die Möglichkeit verwehrt, zu beweisen, dass die Nachrichten der Wahrheit entsprechen – was zur Straflosigkeit führen würde. Deshalb geht der Fall zurück an die Vorinstanz. Die Posts betreffen den Präsidenten des Vereins gegen Tierfabriken, Erwin Kessler. Zu beweisen ist, ob Kessler antisemitische und rassistische Auffassungen vertritt. Nicht geklärt hat das Bundesgericht übrigens die wichtige Frage, ob es sich bei Facebook um ein Medium im Sinne des Strafgesetzbuchs handelt.
Die Bestürzung der Woche
Die SVP fordert, dass die Behandlung der Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose von der Traktandenliste für die Frühjahrssession gestrichen wird. In einem Brief an die Büros von National- und Ständerat schrieben SVP-Präsident Albert Rösti und SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi, sie seien «bestürzt» über die Absicht des Parlaments, das Gesetz bereits in der Frühjahrssession fertig beraten zu wollen. Eine «seriöse und verantwortungsvolle gesetzgeberische Arbeit» sei in dieser kurzen Frist nicht möglich. Was die SVP nicht schreibt: Die Überbrückungsrente soll negative Folgen der Personenfreizügigkeit abfedern. Und ist somit ein starkes Argument gegen die SVP-Begrenzungsinitiative, deren Annahme eine Kündigung der Personenfreizügigkeit zur Folge haben könnte. Für Aeschi ist klar: Sollte das Geschäft in Rekordzeit durchgepaukt werden, zeige dies, dass man im Kampf gegen die SVP-Initiative bereit sei, sämtliche Prinzipien zu opfern. Zum Beispiel die von der SVP immer wieder beklagte parlamentarische Langsamkeit und Ineffizienz?
Bestürzend.
Illustration: Till Lauer