
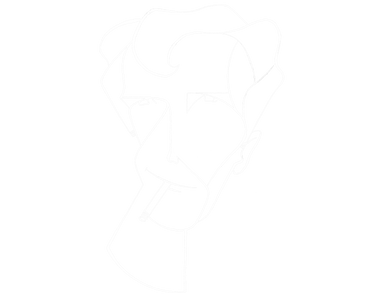
Der, der du niemals sein wirst
Die Wette
Wie verändert sich das Leben, wenn man mit 50 die Diagnose bekommt, eine nicht ganz harmlose psychische Störung zu haben? – Der Pilot zur Kolumne.
Von Constantin Seibt, 13.02.2020
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
«Run, you clever boy, run!»
Clara Oswin Oswald zu Doctor Who, in «Asylum of the Daleks»
Am Ende der ersten Sitzung faltete meine Psychiaterin einen Stoss Fragebögen zusammen. Dann zögerte sie.
«Herr Seibt – sind Sie sicher, dass Sie über sich Bescheid wissen wollen?»
«Warum sollte ich nicht?»
«Sie haben 50 Jahre lang Ihr Leben auch ohne Diagnose auf die Reihe bekommen.»
«Was wäre das Risiko?»
«Es könnte Sie ernüchtern. Nach einer Diagnose verliert die Welt oft viel von ihrem Zauber.»
Ich lachte. «Wenn Sie in diesem Land einen wirklich kompetenten Spezialisten für die Verzauberung von Tatsachen suchen, dann bin ich das.»
Meine Psychiaterin warf ein neutrales Lächeln zurück.
Dann sagte sie: «Na dann – viel Glück.» Und steckte die gefalteten Fragebögen in einen ebenso neutralen Umschlag.
Der Taumel
Es war viel los in der Zeit. Ich hatte meine Stelle gekündigt und gründete mit fünf anderen Leuten gerade ein Unternehmen. So brauchte die Abklärung ein paar Monate.
Ende Februar verliess ich die Praxis erneut mit einem neutralen Couvert.
Der Inhalt wog diesmal wesentlich leichter – vier Seiten A4.
Ich lief mit dem Couvert im Mantel durch die Stadt. Ein kühler Wind wehte, der Schnee taute, und alles – die Autos, die Bäume, der Himmel, ich – war struppig und nass.
Ich fragte mich, ob das, was ich dachte, in Ordnung war. Mit 50 die Diagnose zu bekommen, dass man sein Leben mit einer mittelschweren psychischen Störung verbracht hat, ist eine der wenigen Situationen, für die es nicht den Hauch einer gesellschaftlichen Regel gibt.
Ich zumindest konnte keinen klaren Gedanken fassen, weil ein Sturm von unerwarteter Stärke in mir tobte. Es war Glück. Unverschämt und unverschnitten. Nie zuvor war ich so dankbar gewesen. Nie zuvor so sicher, einen Stern wie kaum jemand anderer zu haben.
Weil sonst viel los gewesen war, hatte ich bis dahin nur zerstreut über die Störung gelesen, deren Diagnose ich nun in der Tasche trug. Aber eines war auch bei der unsystematischen Lektüre von ein paar Analysen, Tipps und Lebensgeschichten nicht zu übersehen gewesen: das Leiden, das sie verursachte.
Und dieses Leiden hatte mich verschont.
Ich hatte alle Ziele meines Lebens erreicht. Und keines hatte sich beim Erreichen als Enttäuschung erwiesen: Alle waren noch fantastischer, als ich mir vorgestellt hatte. Ich war mehr geliebt worden, als ich mir je erträumt hatte. Ich hatte mehr gesehen, verwickelter gedacht, war weiter gekommen, als ich je vermutet hatte. Ich war geworden, was ich werden wollte: ein erstklassiger zweitklassiger Schriftsteller – oder, wenn man will, auch ein erstklassiger drittklassiger. Denn zugegeben: In meiner Branche gab es nicht besonders viel Konkurrenz. Aber egal. Ich wusste, dass ich an einem guten Tag wirklich gut war in meinem Beruf. Dazu hatte ich zu meiner Verblüffung ein fast komplettes bürgerliches Leben: Ich war Vater einer Tochter, hatte Narben aus einer gescheiterten Beziehung und eine Freundin, die klüger als ich war und die ich liebte. Und an der Stelle, die ich gekündigt hatte, hatte ein humorloser Konzern mir zehn Jahre lang ein Honorar bezahlt, das bewies, dass er mich ernsthaft für erwachsen hielt.
Wie ich durch die struppige Stadt ging, fühlte es sich gut an, das alles auf eine Karte gesetzt zu haben. In zwei Monaten würde das entscheidende Crowdfunding stattfinden, mit ungewissem Ausgang. Es fühlte sich sehr frisch und wach an, und ich hörte am Morgen unter der Dusche Amy Macdonald, Songs wie «Let’s Start a Band» oder «(You Don’t Know a Single Thing About the) Youth of Today». Und ich fühlte mich voll Erwartung, als wäre ich eine Schottin am Anfang ihres Lebens.
Ich wusste: Ich würde ein weiteres Mal unverschämt Glück brauchen. Während ich durch den einsetzenden Regen ging, wurde mir klar, wie atemberaubend knapp alles gelaufen war. Immerhin hatte ich bis 31 keinen richtigen Job bekommen – zu viele Leute hatten vor meiner Einstellung gewarnt. Und diesen Job bekam ich auch nur gegen den Protest eines Teils der Belegschaft – und aus einem Missverständnis heraus.
Ich hatte Hilfe gebraucht und sie bekommen. Allein hätte ich wahrscheinlich nicht einmal das Gymnasium geschafft, wenn meine Mutter mich nicht in den ersten Jahren auf Kurs gehalten hätte. Und ich hatte den Rat meines Vaters befolgt, zu tun, was mich faszinierte – in der völlig unbewiesenen Annahme, dass eines Tages jemand dafür Geld zahlen würde.
Wahrscheinlich wäre ich untergegangen, wenn ich nicht alle Privilegien gehabt hätte: Ich war weiss, heterosexuell, Mittelklasse – und am Ende des grössten Wirtschaftsbooms im wohlhabendsten Land des Planeten geboren worden. Bei Licht besehen, war das ein Start, der ein Scheitern fast unmöglich machte. Aber ich hatte sämtliche Privilegien gebraucht, um knapp um die Ecke zu biegen.
Mir wurde klar, wie dankbar ich sein konnte: dem Ehrgeiz meiner Mutter für mich – und ihrer Liebe, die sie nie an Leistung koppelte; der nachlässigen Freiheit und dem amerikanischen Grinsen meines Vaters; der Schweiz des Kalten Kriegs, die zur Zeit meiner Jugend so betonsolid war, dass ich jede Dummheit als Erfrischung verkaufen konnte; einigen erstaunlich oft eher bürgerlichen Chefs, die ihren Job so souverän machten, dass sie meine Existenz nicht fürchteten; allen Frauen, die mich für eine Nacht oder ein Jahrzehnt von dem Schicksal erlöst hatten, als Ausserirdischer zu leben; der Literatur, in der nicht die Wahrheit, sondern die Sehnsucht und das Zwielicht zählten; dem Zufall, in einem Beruf gelandet zu sein, wo meine Schwächen zu Stärken wurden; und meinem miserablen Gedächtnis für eigene und fremde Widerlichkeiten, das mir ein kurzes, aber helles Leben in die Erinnerung pflanzte.
Dass mein Glück unverdient war, machte es umso solider. Ich war überzeugt, dass Napoleon recht gehabt hatte, als er von seinen Generälen als wichtigste Tugend fortune verlangte. Fleiss, Hartnäckigkeit, Handwerk – das liess sich machen. Aber den Stern, den musste man geschenkt bekommen. Und ich war offensichtlich unter einem geboren worden, der gegen alle Wahrscheinlichkeit arbeitete.
Drei Tage riss mich der Sturm fort. Dann, im ersten, kurzen Moment der Windstille, fiel mir unter der Dusche ein erster Grund ein, warum das Leiden mich verschont hatte: Ich hatte es auf viele Schultern verteilt – auf alle, die mit mir arbeiteten, und alle, die mich liebten. Auf die meiner Kollegen, meiner Chefs, meiner Familie, meiner Freunde, nicht zuletzt auf die meiner Freundinnen.
«Gerecht auf viele Schultern verteilt!», dachte ich, während ich das Wasser ein paar Grad wärmer stellte.
Oh boy.
Nun, die erste Runde der Wette hatte ich gewonnen. Zumindest die unmittelbare Folge meiner Diagnose war das Gegenteil von Ernüchterung – ein besinnungsloser Rausch. Es dauerte Tage, bis die ersten Zweifel eintrudelten, Wochen, bis ich einen Plan (und Psychopharmaka) hatte, Monate, bis ich zum Schrecken meiner Umgebung Verantwortung übernehmen würde.
Kurz: Ich hatte wieder einmal keine Ahnung. Aber genau das fühlte sich grossartig an.
Warum mit dieser psychischen Störung wenig anderes übrig bleibt, als gegen die Wahrscheinlichkeit zu leben. «Der, der du niemals sein wirst», Folge 1: Sabotage.
Illustration: Alex Solman