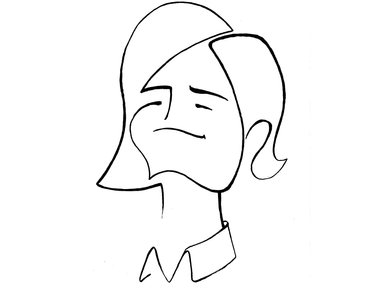
Das traurige Krippenspiel
Globegarden steht für das Versagen eines Unternehmens. Doch bei der Frühbetreuung versagt auch die Schweizer Politik.
Von Daniel Binswanger, 21.12.2019
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
In verschiedenen Politikfeldern ist die Schweiz – eines der globalisiertesten, reichsten und, so könnte man meinen, fortschrittlichsten Länder der Welt – verblüffend rückständig. Man sollte sich immer mal wieder der Verspätung erinnern, mit der die Eidgenossenschaft das Frauenstimmrecht eingeführt hat, und besser nicht der Illusion erliegen, wir hätten seither aufgeschlossen zur gesellschaftspolitischen Avantgarde. Wahr ist häufig das Gegenteil.
Jetzt also der Globegarden-Skandal – und der Skandal einer Aufsichtsbehörde, die sich allen Ernstes so benimmt, als gäbe es gar kein Problem. Die von der Republik angeprangerten Missstände bei Globegarden, dem grössten privaten Krippenbetreiber in der Schweiz, müssen von den Besitzern und der Unternehmensleitung verantwortet werden. Sie sind jedoch auch ein Symptom der gravierenden Defizite, die das ganze System der Schweizer Frühbetreuung untergraben. Sie sind das Ergebnis einer Politik, die sich nicht leiten lässt von den realen Gesellschafts- und Familienstrukturen, sondern von einem ideologisierten Affektgemenge aus Staatsfeindlichkeit und Antifeminismus. Ob das neue Parlament mit seinem stark erhöhten Frauenanteil nun endlich eine Wende einleitet, bleibt offen. Gesichert – das zeigt auf eindrückliche Weise die Globegarden-Recherche – ist einzig der Handlungsbedarf.
Als allgemein anerkannt gilt heute die Erkenntnis, dass bildungspolitisch nichts so sinnvoll ist wie gute Betreuungsangebote für Kleinkinder zwischen 0 und 4 Jahren. In keinem anderen Bereich der Nachwuchsförderung können öffentliche Gelder mit vergleichbarer Hebelwirkung eingesetzt werden – wie vor kurzem etwa wieder ein Unesco-Bericht in Erinnerung gerufen hat. Und wo steht die Schweiz bei der Frühförderung im Vergleich zu allen anderen OECD-Staaten? Auf dem allerletzten Platz.
Laut OECD-Statistik beträgt der für die 0- bis 5-Jährigen vorgesehene Anteil am Gesamtbudget für Kinder bis 17 Jahre, welches die Familien- und Bildungsausgaben umfasst, lediglich 15 Prozent – gerade mal etwa halb so viel wie in Frankreich, Deutschland, Österreich oder Luxemburg. Obwohl bei der Vergleichbarkeit zwischen den Ländern eine gewisse Vorsicht geboten ist, könnten die Zahlen deutlicher gar nicht sein: Im Verhältnis zur Gesamtsumme der Bildungs- und Familienförderungsausgaben vernachlässigen wir die Frühförderung auf spektakuläre Weise. Entweder die Eidgenossen sind aufgrund einer magischen Besonderheit samt und sonders förderungsunbedürftige Wunderkleinkinder – oder wir haben es mit einer absurden Fehlallokation zu tun.
Was ist die offizielle Krux der helvetischen Frühbetreuung? Sie kostet viel zu viel, lautet die gängige Analyse. Worin liegt die Lösung? Darin, dass bürokratische Hürden beseitigt und überflüssige Qualitätssicherungsmassnahmen und Regulierungen abgeschafft werden. Dann werden die Krippen nicht nur viel billiger, sondern auch gleich noch viel besser – sollte man jedenfalls meinen. Das Problem ist lediglich, dass an dieser reflexartigen Standardantwort ganz einfach alles falsch ist.
Eine aufwendige Studie aus dem Jahr 2015, die von Infras und dem Institut für Empirische Wirtschaftsforschung der Universität St. Gallen im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen durchgeführt wurde, vergleicht die Frühbetreuung in Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Sie kommt zu einem glasklaren Befund: Schweizer Krippen sind nicht teuer.
Für Standorte im Kanton Zürich und in der Waadt (Stadt- und Landgemeinden) errechnete die Studie durchschnittliche Vollkosten von 112 beziehungsweise 111 Franken (der Untersuchungszeitraum liegt schon etwas zurück). Das liegt nur leicht über dem Kostenschnitt in den umliegenden Ländern (104 Franken). In den urbanen Zentren sind die Vollkosten eines Betreuungstages in Deutschland (Frankfurt) und Frankreich (Lyon) sogar deutlich höher als in der Schweiz, nämlich 136 Franken. Kaufkraftbereinigt bewegen sich die Kosten eines Schweizer Krippenplatzes auf derselben Höhe wie in den Nachbarländern. Die Fama vom kostentreibenden helvetischen Überperfektionismus ist schlicht und einfach Humbug.
Kinderbetreuung ist – wie Olivia Kühni gestern hier in ihrer Hintergrundanalyse dargelegt hat – eine Dienstleistung, deren Kostenbasis weitestgehend aus Personalkosten besteht. Man hat in der Schweizer Diskussion so getan, als wären überzogene Bau- und Hygienevorschriften daran schuld, dass die Krippentarife so hoch sind. Auch diese Behauptung ist Nonsens.
Gemäss der zitierten Studie entfallen im Schnitt 72 Prozent der Gesamtkosten eines Krippenplatzes auf die Löhne. Weitere 14 Prozent müssen in Zürich eingesetzt werden, um die Mietausgaben zu decken. Etwas an Hygienevorschriften oder baulichen Vorgaben herumzuschrauben, würde marginale Kostensenkungen bringen. Einschneidende Ersparnisse lassen sich an genau einem Ort erzielen: beim Personal.
Man könnte beispielsweise den Betreuungsschlüssel noch weiter senken – eine Bestrebung, die im Kanton Zürich bereits in vollem Gange ist. Oder man könnte die Betreuerinnen noch schlechter bezahlen, die Arbeitsverhältnisse noch prekärer werden lassen, das Ausbeuten von Praktikantinnen noch systematischer betreiben, die Fluktuation noch weiter forcieren. Diese Lösung scheint für private Krippenbetreiber eine ständige Versuchung darzustellen – und dann im Extremfall zu Zuständen zu führen, wie sie bei Globegarden vorherrschen.
Wenn es nicht die realen Kosten sind, was unterscheidet dann das deutsche, österreichische oder französische Krippensystem von demjenigen der Schweiz? Genau ein Faktor: die öffentlichen Subventionen. In der Schweiz wird der Löwenanteil der Frühbetreuung von den Eltern getragen. In der Stadt Zürich sind es 70 Prozent. Die 30 Prozent öffentliche Kostendeckung kommen zudem vornehmlich einkommensschwachen Familien zugute, der Mittelstand wird geschröpft. In unseren Nachbarländern beträgt der öffentliche Finanzierungsanteil mindestens 75 Prozent. In den urbanen Zentren liegt er häufig auch sehr viel höher, in der Stadt München zum Beispiel bei 85 Prozent. Alle Krippenplätze sind stark subventioniert, und Eltern bezahlen überall in Frankreich, Deutschland und Österreich maximal 20 bis 40 Prozent der Vollkosten.
Das ist die fürchterlich banale Wahrheit: Fast alle europäischen Länder lassen sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie viel Geld kosten. Weil der Doppelverdiener-Haushalt zur Normalität geworden ist, weil die Berufstätigkeit der Frauen für die Volkswirtschaften nötig und für die Gleichstellung unverzichtbar ist, weil vernünftige Geburtenraten im eminenten Interesse der Gesamtbevölkerung liegen. Fast alle europäischen Länder ausser die Schweiz. Wir halten uns stattdessen an eine lieb gewordene Lebenslüge: Vereinbarkeit, wenns unbedingt sein muss – aber bitte nur zum Nulltarif!
Wer ist für dieses gleichstellungspolitische und wirtschaftspolitische Desaster verantwortlich? Die bürgerlichen Parteien. Es waren FDP-Politiker wie der selbst ernannte Krippenexperte Filippo Leutenegger, die jahrelang breitbeinig durch die Fernsehstudios zogen, um den Miteidgenossen darzulegen, dass das Betreuungskosten-Problem lediglich durch überzogene Bauvorschriften und staatliche Schikanen verursacht werde – sehr zum Entzücken der reaktionären Gleichstellungsfeinde. Es war die SVP, die mit ihrer «Staatskinder»-Kampagne 2013 den ohnehin völlig zahnlosen Familienartikel versenkt hat. Und es war eine bürgerliche Phalanx aus SVP, CVP und FDP, die 2016 im Kanton Zürich die Initiative «Für eine bezahlbare Kinderbetreuung» abwehrte. Immerhin schlugen sich die BDP und die EVP ins Ja-Lager. Die GLP beschloss wieder einmal Stimmfreigabe.
Es liessen sich weitere Beispiele nennen. Auch heute spürt man von einem Gesinnungswandel kaum einen Hauch. Die FDP hat vor drei Monaten im Zürcher Kantonsrat einen Vorstoss gemacht mit dem Ziel, die Regulierung und die Qualitätskontrolle für Kinderkrippen «auf das Minimum zu reduzieren». CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner hat die Debatte zu beruhigen versucht mit dem Hinweis, dass ab Frühjahr 2020 der obligatorische Betreuungsschlüssel ohnehin gesenkt werde. Zusätzliche Lockerungsmassnahmen seien ebenfalls beschlossen. Der Ausverkauf der Qualitätsstandards wird zur offiziellen Rückfallposition der bürgerlichen Gleichstellungspolitik.
Wir sollten dieser Heuchelei ein Ende setzen. Entweder die bürgerlichen Parteien nehmen die Sache des Feminismus und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ernst. Dann müssen sie bereit sein, dafür Geld auszugeben. Oder sie halten fest am schlanken Staat als heiligster Mission, dann sollen sie auch klar deklarieren, dass bürgerliche Politik für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht zuständig ist. So viel Ehrlichkeit muss sein. Das Herumlavieren auf dem Rücken der Kinder richtet Schaden an.
Illustration: Alex Solman