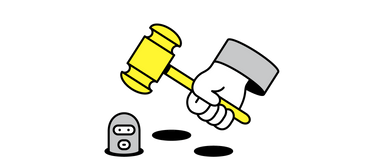
Beschuldigt. Verurteilt. Unter Beobachtung.
Vor viereinhalb Jahren verübten Vermummte einen Farbanschlag auf einen Berner Polizeiposten. Im März dieses Jahres muss ein 23-jähriger Student für den Vorfall geradestehen – er wird verurteilt. Die Strafe und die damit verbundenen Kosten verändern sein Leben.
Von Daria Wild, 02.10.2019
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Wie funktioniert das Schweizer Gerichtssystem? Wer sich im Internet informieren will, landet schnell bei einer Grafik des Bundes. In freundlichen Farben, von Gelb bis Pink, zeigt sie griechische Säulenpalästchen (für die Gerichte), Paragrafen (für das Gesetz) und Männchen, die Kläger oder Staatsanwälte repräsentieren. Was die Grafik nicht zeigt, das sind die Menschen, die als Verurteilte aus einem Gerichtssaal treten. Ihr Schicksal bleibt auch in der öffentlichen Wahrnehmung meist unbeachtet. Wie geht es einem, der nach einem Schuldspruch den Alltag meistern muss? Mit dem Damoklesschwert einer vierjährigen Probezeit lebt?
Ort: Regionalgericht Bern-Mittelland
Zeit: 27. März 2019, 9 Uhr
Fall-Nr.: PEN 18 493
Thema: Sachbeschädigung, Landfriedensbruch
Im Februar 2015 werden der Polizeiposten am Berner Waisenhausplatz, das Amtshaus und das Gefängnis sowie diverse Dienstfahrzeuge zur Zielscheibe eines Farbanschlags. Der Sachschaden ist gross, Menschen werden nicht verletzt. Die Aktion ist politisch motiviert, in einem Bekennerschreiben wird die «Wut gegen das Herrschaftssystem» zum Ausdruck gebracht; die Gruppe zieht sich nach dem Anschlag in die Reitschule zurück.
Die Reaktionen: Der damalige Sicherheitsdirektor Reto Nause spricht von «terrorähnlichen Verhältnissen», bürgerliche Kräfte fordern wieder einmal die Schliessung des Kulturzentrums Reitschule, Journalisten ziehen aus, um Extremismusexperten zu suchen.
Dementsprechend gross ist der Aufwand, den die Polizei betreibt. Im April und August 2015 macht sie mit bewaffneten Grossaufgeboten Hausdurchsuchungen, fesselt und verhaftet mehrere Personen aus dem Umfeld der Berner Besetzerszene. Die Razzien werden scharf kritisiert, das betroffene Besetzerkollektiv wirft der Polizei Fichierung vor.
Danach fliesst erst mal sehr viel Wasser die Aare hinunter. Die Ermittlungen verlaufen sich, die Hausdurchsuchungen ergeben nichts. Erst im Frühjahr 2016 stossen die Behörden per Zufall auf einen Studenten. Polizisten haben ihn angehalten und mitgenommen, und die DNA, die der Mann abgeben muss, stimmt mit einer DNA überein, die auf einem Latexhandschuh gefunden worden war. Dieser Handschuh lag gemäss Polizei in jener Nacht in der Nähe des Polizeipostens Waisenhausplatz – wo genau, ist nicht dokumentiert. In den Augen der Ermittlungsbehörden ist die Verbindung zwischen dem Studenten und dem Farbanschlag damit hergestellt.
Spätsommer 2019. Auf der Terrasse eines Berner Cafés mit Blick auf die Aare sitzt M. C.*, inzwischen 23 Jahre alt, ein gescheiter, junger Mann, wach, aufmerksam. Wenn er spricht, spricht er überlegt, wägt ab, antwortet ruhig. Im März dieses Jahres ist er zu 16 Monaten Freiheitsstrafe bedingt verurteilt worden, bei einer Probezeit von vier Jahren. Dazu kommt eine teilbedingte Geldstrafe von 145 Tagessätzen à 30 Franken. 65 Tagessätze muss er bezahlen, 80 werden bedingt aufgeschoben, wiederum bei einer Probezeit von vier Jahren. Die Verfahrenskosten betragen fast 19’000 Franken. In dieser Summe sind die Schadenersatzbegehren noch nicht mit eingerechnet.
Dieser Prozess und der Schuldspruch sind bisher das einzige Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen in Sachen Farbanschlag. Die Schilderungen des verurteilten Studenten beginnen mit der Hausdurchsuchung, wenige Monate nachdem er angehalten worden war.
Um seine Perspektive soll es hier gehen.
Phase eins: vor dem Prozess
M. C. berichtet: «Die Polizisten kamen am 24. August 2016, morgens um 6 Uhr, zu mir nach Hause und holten mich auf den Posten. Sie sagten mir weder, wie lange ich bleiben muss, noch, was jetzt passieren werde. Ich hätte eigentlich arbeiten müssen. Doch ich sass in einer Zelle und wartete. Sie ordneten eine erkennungsdienstliche Erfassung an (das sind Fingerabdrücke und eine DNA-Abgabe, Anm. d. Red.), obwohl sie ja schon eine DNA-Spur von mir hatten. Dann wurde ich verhört. Der Fallleiter war da, der sagte, worum es ging, warum sie mich geholt hätten, dass sie wegen der DNA-Spur auf mich gekommen seien.
Sie warfen mir bereits auf dem Posten eine polizeifeindliche Haltung vor. Ich verweigerte die Aussage, und natürlich behaupteten sie dann, wenn ich unschuldig wäre, würde ich etwas sagen. Der Fallleiter drohte mir mit Haft; ich solle besser jetzt die Verantwortung übernehmen, sonst werde es noch schlimmer. Das sei kein Spass, es sei ja klar, dass ich in jener Nacht beim Waisenhausplatz dabei gewesen sei. Die Polizisten taten so, als seien sie sich ganz sicher.
Es war schon sehr speziell, dass sie mich nicht einfach vorgeladen haben, ich glaube, das gehört zur Einschüchterungstaktik; das Eintreten der Tür am frühen Morgen, die Versuche, ein Geständnis zu erzwingen. Danach sass ich nochmals eine Stunde in einer Zelle, am Nachmittag konnte ich raus. Sie sagten mir immer noch nicht, wie es nun weitergeht.
Natürlich ahnte ich, dass da etwas auf mich zukommt, aber ich versuchte, mein Leben weiterzuleben. Im August 2017 informierten mich die Behörden, dass ich mir einen Anwalt suchen müsse. Schon einen Monat später kam die Anklageschrift, das war sehr belastend. Ich hielt es damals nicht für möglich, dass ich für jeden einzelnen Schaden aufkommen muss – weil: Auch wenn ich dabei gewesen wäre, viele der Schäden hätte ich gar nicht allein verursachen können. Aber ich wusste, ich kann nicht viel machen. Ich wartete einfach ab, liess das über mich ergehen. Es gab ja auch ein paar gute Zeichen; dass das Verfahren sehr unklar war, dass es keine eindeutigen Spuren gab, dass nicht sauber gearbeitet wurde.»
Phase zwei: am Gericht
Für die Einzelrichterin am Regionalgericht Bern-Mittelland ist der Fall jedoch eindeutig: Bettina Bochsler folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilt M. C. Die vielen Einwände von Verteidiger Hans Keller lässt sie nicht gelten.
Keller sagt: DNA-Spuren seien grundsätzlich zweifelhaft – weil es, wie wissenschaftliche Studien zeigten, zu Zweitübertragungen kommen könne. Auf der Videoaufnahme über den Vorfall sei zudem kein einziger Angreifer zu sehen, der am Handy hantiere. Sein Mandant habe jedoch just zur Zeit des Angriffs – auf die Sekunde genau – seiner damaligen Freundin eine SMS geschrieben. Und die vier Jahre Probezeit, die von der Staatsanwältin gefordert würden, seien für einen nicht Vorbestraften unüblich lang.
«Es schien mir», sagt Rechtsanwalt Hans Keller bei einem Gespräch in Bern, ein halbes Jahr nach der Urteilsverkündung, «als wären unsere Argumente nicht auf offene Ohren gestossen. Als würde uns die Richterin gar nicht mehr zuhören müssen.»
M. C. berichtet: «Es war eine sehr negative Stimmung im Gerichtssaal. Die Staatsanwältin beschrieb mich als Staatsfeind, als einen Menschen voller Hass. Ich habe in der Pubertät zwar gerne angeeckt, aber ich bin jetzt 23 Jahre alt, und ich trage weder Hass in mir, noch halte ich etwas von Gewalt. Doch die Richterin übernahm dieses Bild, sie sah mich als unverbesserlichen Kriminellen, der mit den falschen Freunden verkehrt. Ich hatte das Gefühl, ich hätte da drinnen alle gegen mich, niemand würde es gut mit mir meinen. Als könne ich überhaupt nichts richtig machen.
Die Richterin stand wohl unter Druck und musste hart durchgreifen. Natürlich sahen die Behörden den Angriff auf den Polizeiposten als Angriff gegen sich selbst – und handelten dementsprechend. Ich glaube deshalb, an mir wurde ein Exempel statuiert, ich musste den Kopf hinhalten. Sie sahen mich als eine Person, die nicht ins Konzept passt und deshalb bestraft werden muss. Meine Freunde kamen an den Prozess, das half.»
M. C. wird unter anderem wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung verurteilt. Der Schuldspruch umfasst mehrere Sprayereien, die ihm einzig aufgrund von Skizzenvergleichen zugeschrieben werden, sowie den gesamten Sachschaden von jener Nacht im Februar 2015. Das sind nahezu 100’000 Franken – exklusive Verfahrens- und Anwaltskosten.
Solidarhaftung nennt man das, wenn Einzelne für einen Gesamtschaden büssen müssen. Wer einer Gruppe zugeordnet werden kann, haftet strafrechtlich unter Umständen für den gesamten Schaden, eine individuelle Zuschreibung einzelner Taten ist nicht nötig. Landfriedensbrüche sind ein Beispiel dafür.
Die Fragen, die so ein Urteil aufwirft, liegen auf der Hand: Ist es gerecht, dass einer für einen Schaden aufkommt, den er (wenn überhaupt) unmöglich allein begangen haben kann? Dient ein Urteil wie dieses vor allem der Generalprävention, also der Abschreckung? Nimmt das Gericht dabei den Kollateralschaden in Kauf, dass ein Einzelner möglicherweise zu hart bestraft wird? Es sind Fragen, die – losgelöst von einzelnen Fällen – die Gerichtssäle verlassen und rechtsphilosophisch werden. Sie münden in der Frage:
Was nützen hohe Strafen, was nützen hohe Bussen?
Doch zurück zu M. C. Dass das Urteil gegen den 23-Jährigen nicht milder ausgefallen ist, begründet sein Verteidiger folgendermassen: Die Richterin sei von einer langen Delinquenzzeit ausgegangen, wegen der Sprayereien. Und sie traue ihm keinen Gesinnungswandel zu. Andererseits sei der Entscheid auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas, das in den Gerichtssälen Einzug gehalten habe. «Das Klima ist verhärtet. Es wird schematischer geurteilt, komplexere Entlastungsargumente werden kaum mehr gehört.» Hans Keller sagt auch: «Strafen haben immer einen präventiven Charakter.»
Ähnlich argumentiert die Richterin, die M. C. verurteilt hat. «Strafen sollen gemäss Lehre und Rechtsprechung immer auch einen präventiven Charakter haben, spezialpräventiv und generalpräventiv. Insofern ist das bei allen Fällen so», sagt Bettina Bochsler im Gespräch mit der Republik. Dass das Gericht in diesem Fall unter Druck gestanden sei, verneint sie. Ein verhärtetes Klima, wie es Verteidiger Hans Keller beschreibt, könne man so pauschal nicht feststellen. Und doch weist auch die Richterin auf eine Veränderung hin: «Die Polizei erstattet spürbar mehr Anzeigen als früher.»
Phase drei: nach dem Prozess
Das Verfahren sitzt M. C. noch in den Knochen, das Urteil im Nacken. Mit dem Schuldspruch sitzt der 23-Jährige unvermittelt auf einem Schuldenberg von über 140’000 Franken; zusammengesetzt aus Schadenersatz- und Verfahrenskosten. Weil er mit seinem Nebenjob nur wenig verdient, wird er die Rechnungen nicht bezahlen können, die ersten Betreibungen laufen bereits. Und: Die Probezeit erlaubt es den Behörden, ihn weiterhin an der Kandare zu halten.
M. C. berichtet: «Es war schon extrem, von dieser Pushnachricht vom ‹Bund› zu hören, die sofort nach dem Prozess meine Verurteilung verkündete. Zwei Tage lang, während des Prozesses und der Urteilseröffnung, war das Medieninteresse gross. In der Zeitung wurde jedoch nur die Sicht der Richterin und der Staatsanwaltschaft wiedergegeben. Niemand kam auf die Idee, mich zu fragen, ich hatte keine Stimme. Wenn man das las, was da in der Zeitung stand … Das war schlimm. Ich fühlte mich kriminalisiert, blossgestellt.
Meine Mutter erfuhr es aus den Medien, sie wusste zwar, dass ich ein Verfahren hatte, aber sie war schockiert. Das hätte wirklich nicht sein müssen, das waren schlimme Tage. Ohne die Solidarität meiner engsten Freunde wäre ich wohl untergegangen. Ich hätte das Urteil gern weitergezogen, aber das Risiko, noch mehr Kosten zu haben, schreckte mich ab, und ich wünschte mir ein Ende dieses Prozesses.
Ausser meinen Freunden erzählte ich niemandem davon. Ich ging weiter an die Uni, ich musste eine Arbeit schreiben. Zwischendurch befürchtete ich, die Universität würde herausfinden, wer ich sei, und mich rausschmeissen, aber das passierte zum Glück nicht. Meine Eltern decken mir die Lebenskosten ab. Alles, was ich mit meinem Job als Sporttrainer dazuverdiene, geht für diese Rechnungen drauf. Da frage ich mich schon, was eine so hohe Strafe nützt und vor allem die horrenden Kosten, die auf mich zukommen. Der Staat will doch, dass ich studiere, gut ausgebildet bin, aber mit solchen Kosten legt er mir einen riesigen Stein in den Weg.
Manchmal habe ich Angst davor, dass plötzlich niemand mehr weiss, womit ich zu kämpfen habe, was mich psychisch belastet. Seit drei Jahren werde ich jetzt beobachtet. Wenn solche Gedanken hochkommen, beruhigen mich meine Freunde. Sie sagen: ‹Egal, wie lange das geht, wir stehen das gemeinsam durch.› Wenn ich bei ihnen bin, gelingt es mir, die Probezeit nicht jeden Tag im Kopf zu haben. Da frage ich mich schon, was sich die Richterin dachte, als sie sagte, ich solle mich sofort von meinem Umfeld distanzieren. Wenn ich das nicht hätte, würde ich untergehen. Dann wäre ich komplett allein, mit einem riesigen Berg an Schulden.
Heute überlege ich mir bei jeder SMS, wer wohl mitliest. Das Schlimmste daran ist, dass Personen betroffen sind, die einem am nächsten stehen. Meine damalige Freundin beispielsweise wurde mehrmals verhört, obwohl sie absolut nichts damit zu tun hatte. Ich gehe auch davon aus, dass meine heutige Freundin unter Beobachtung steht. Und dass das Telefon meiner Eltern abgehört wird. Solche Repressionen erleben zu müssen, ist sehr belastend.
Ich versuche, das alles zu verdrängen, aber die Gedanken sind da. Gegenüber meiner Freundin und meinen Eltern habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber das ist wohl das Ziel der Kontrolle: dass man sich so verhält, wie es staatlich erwünscht ist.»
* Der Name des 23-jährigen Verurteilten ist der Redaktion bekannt, die Initialen wurden verändert.
Illustration: Till Lauer