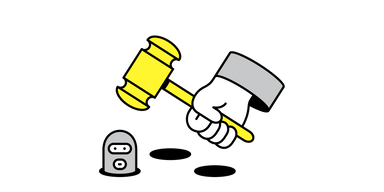
Dramen des Alltags
Es sind die stinknormalen Unzulänglichkeiten menschlicher Beziehungen, die die Gerichte am meisten beschäftigen – nicht Mord und Totschlag. Auf Teufel komm raus wird behauptet, gefordert und gestritten. Mit mehr oder weniger Erfolg.
Von Brigitte Hürlimann, 11.09.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Ort: Bezirksgericht Pfäffikon ZH
Zeit: 5. September 2019, 10 Uhr, 11.15 Uhr, 15 Uhr
Thema: Rechtsöffnung, Forderung
Blick aus dem Fenster im ersten Stock, am Ende eines langen, schmucklosen Flurs. Es ist Schweizer Idylle pur, die sich hier offenbart. Ein Einfamilienhausquartier im Zürcher Oberland, am Rande des Waldes. Gelbe Wanderwegweiser an der Weggabelung, ein bis zwei Autos vor jedem Haus, die Grillmaschine sorgsam mit einer Plastikhaube zugedeckt, Solarpanels auf dem Scheunendach, eine Schweizerfahne am Masten, eine Gruppe von Hortkindern mit zwei Betreuerinnen auf dem Weg in den Wald, Hündeler mit Leinen um den Hals, an denen Robidog-Säcklein angeknotet sind, Seniorinnen auf dem Morgenspaziergang, fröhlich tratschend.
Eine Bilderbuchschweiz, ruhig und friedlich. Doch wo Menschen aufeinanderprallen, gibt es unweigerlich Streit. In der Regel zwar ohne Messer, ohne Gewalt und ohne wüste Worte und Drohungen. Aber auch die vordergründig anständig und mit legalen Mitteln ausgefochtenen Fehden werden unerbittlich ausgetragen – mit erstaunlich langem Schnauf. Denn was trifft uns mehr, als wenn unsere Vorgesetzten, unsere Vertragspartnerinnen oder gar unsere Liebsten nicht so tun, wie wir es wollen?
An jedem Gericht stellen genau diese Auseinandersetzungen den Hauptteil der täglichen Arbeit dar. Beispiele gefällig?
Wir befinden uns im kleinen, ländlichen Bezirksgericht Pfäffikon, oberhalb des Bahnhofs gelegen, in einem Gebäudekomplex der späten 1970er-Jahre, der auch noch ein Gefängnis und einen Posten der Kantonspolizei beherbergt. Es ist ein trüber, frühherbstlicher Donnerstag, Regenwolken ziehen auf, und das Verhandlungsprogramm lautet: Rechtsöffnung, Rechtsöffnung, Rechtsöffnung, Rechtsöffnung, Rechtsöffnung, Forderung.
Kein Wunder, hält sich der Zuschauerandrang in Grenzen.
Doch hinter solch nichtssagenden Begriffen verbergen sich Dramen. Es geht um wirtschaftliche Existenzen und emotionale Ausnahmezustände. All das, was man im Strafrecht vermutet, haben auch die zivilen Verfahren zu bieten, die übrigens ebenfalls öffentlich sind, ausser den Familienangelegenheiten wie Scheidungsverhandlungen, das daily business eines jeden erstinstanzlichen Gerichts. Aber zurück nach Pfäffikon, wo gerade die erste Verhandlung beginnt.
10 Uhr, Rechtsöffnung. Bei diesem Stichwort befinden wir uns in der Sphäre des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts. Es geht darum, ob die Betreibung vollzogen werden kann oder nicht. Ein Albtraum für die Betroffenen. Zwei Frauen nehmen im Gerichtssaal Platz, die Verhandlung wird von Vizepräsidentin Yvonne Mauz geleitet. Klägerin in diesem Verfahren ist die Mutter einer jungen Frau, die nicht die Kraft findet, selber vor Gericht zu erscheinen. Sie hat ihre Mutter als Vertreterin bevollmächtigt und wartet draussen das Geschehen ab. Am anderen Ende des Tisches sitzt die ehemalige Arbeitgeberin der Tochter. Sie nimmt die Rolle der Beklagten ein.
Thema ist eine definitive Rechtsöffnung. Die klagende Tochter erhofft sich vom Gericht die Ermächtigung dafür, dass sie ihre frühere Arbeitgeberin im Betrag von rund 5700 Franken betreiben kann. Diesem Rechtsakt, der nur wenige Minuten dauert, ging ein langwieriger, komplexer arbeitsgerichtlicher Streit voran, mit vielen gegenseitigen Forderungen und Anschuldigungen. Von alldem ist im Rechtsöffnungsverfahren nur am Rande die Rede. Die Arbeitgeberin wehrt sich gegen die Betreibung und sagt, die frühere Arbeitnehmerin schulde ihr ebenfalls noch Geld, mehr als 20’000 Franken, sie wolle die 5700 Franken mit diesen Schulden verrechnen.
Die Richterin hört sich die Ausführungen der beiden Frauen an. Dann erklärt sie die Verhandlung für beendet und teilt mit, das Urteil werde schriftlich eröffnet und den Parteien im Dispositiv zugestellt, per Post. Das Verdikt trifft wenige Tage nach dem Prozess ein – und es fällt zugunsten der klagenden Tochter aus. Die definitive Rechtsöffnung für die geforderten 5700 Franken plus Verzugszinsen wird ihr erteilt. Die Arbeitgeberin kann das Urteil allerdings noch anfechten.
11.15 Uhr, Rechtsöffnung. Im Viertelstundentakt lädt das Bezirksgericht Pfäffikon zu Verhandlungen über die definitive Rechtsöffnung ein, denn häufig erscheinen die Prozessparteien nicht – weil sie dies nicht müssen. In diesem Verfahrensstadium dürfen nur noch wenige Einwände gegen eine Betreibung erhoben werden, deshalb ersparen sich viele den Gang vor Gericht. Sie könnten geltend machen, die Schuld sei inzwischen bezahlt worden, oder eben eine Verrechnung verlangen, wie dies die Arbeitgeberin vergebens versucht hat.
An diesem Verhandlungsmorgen erscheint an drei Terminen hintereinander kein Mensch: weder Gläubiger noch Schuldnerin. Der Blick aus dem Fenster verkürzt die langen Wartezeiten. Und siehe da, kurz vor dem Mittag wetzt doch noch ein junger Mann durch den Gang, mit Unterlagen und Couverts bewaffnet. Er wirft der Gerichtsreporterin einen bösen Blick zu und verkrümelt sich in eine Ecke. Nach der Verhandlung wird er sich mit einem handshake für sein Verhalten entschuldigen: Er habe gemeint, bei der Journalistin handle es sich um eine Vertreterin der Gegenpartei, also der Klägerin und Gläubigerin. Der Irrtum ist nachvollziehbar, denn wer rechnet bei einem Rechtsöffnungsprozess schon mit der Präsenz von Medienleuten?
Yvonne Mauz klärt zu Beginn jedes Prozesses die Parteien darüber auf, dass die Verhandlungen öffentlich seien und eine Journalistin hinten in den Zuschauerreihen sitze. Das führt zwar zu Erstaunen, aber zu keinen Protesten: die übrigens auch nichts genützt hätten, denn die Öffentlichkeit der Gerichtsverfahren hat Menschenrechtscharakter und steht nicht im Belieben der Parteien; mit wenigen Ausnahmen, wenn es etwa um den Opferschutz oder um jugendliche Beschuldigte geht. Der Öffentlichkeitsgrundsatz ist eine Errungenschaft der Aufklärung – eine Massnahme gegen die Kabinettsjustiz.
Für den jungen Mann, der die Rolle des Beklagten einnimmt, endet die Sache auf jeden Fall gut. Er wedelt im Saal mit drei amtlichen Couverts in der Luft und sagt, das sei doch unmöglich, dass er immer wieder Zahlungsaufforderungen des Friedensrichteramts bekomme: «Es ist völlig klar, dass ich diese Kosten nicht zu tragen habe.»
Hintergrund ist der Verkauf seiner Firma. Als dieser bereits vollzogen ist, verlangt ein Gläubiger Zahlungen, aber nicht etwa vom neuen Geschäftsinhaber, sondern von dessen Vorgänger, also vom Verkäufer: dem Mann mit dem bösen Blick. Der neue Inhaber habe längst anerkannt, sagt der angebliche Schuldner, dass er die Rechnungen begleichen müsse, plus die Kosten des Friedensrichterverfahrens.
Es geht um 270 Franken.
Mit all diesen Einwänden setzt sich das Gericht nicht auseinander, sondern tritt auf das Rechtsöffnungsbegehren des Friedensrichteramts gar nicht ein. Der Grund: Das Amt ist nicht befugt, ausstehende Verfahrensgelder einzufordern, es ist nicht Gläubigerin der geltend gemachten Schuld. So auf jeden Fall die Auffassung des Bezirksgerichts. Falls das Friedensrichteramt damit nicht zufrieden ist, stehen auch ihm Rechtsmittel gegen die Verfügung offen.
Der vorerst rehabilitierte Schuldner verlässt mit einem zufriedenen Lächeln den Saal.
15 Uhr, Forderung. Auch der Nachmittag steht ganz im Zeichen von angedrohten Betreibungen, Bestreitungen, Forderungen und Gegenforderungen. Doch nun geht es um eine Herzensangelegenheit, um die Aufarbeitung einer vergangenen Liebesbeziehung, das Ende eines Konkubinats; das sich, gelinde gesagt, harzig gestaltet.
Vor dem grossen Gerichtssaal versammelt sich eine Gruppe von Menschen: der Kläger (ein angehender Anwalt, der sich selbst vertritt), die Beklagte mit ihrem Rechtsanwalt und ihrem Bruder im Schlepptau sowie ein Dolmetscher, der für die französischsprachige Ex-Konkubinatspartnerin die Ausführungen des Richters übersetzt. Es ist Gerichtspräsident Thomas Rehm, der in diesem Verfahren den Vorsitz übernimmt, und es steht ihm ein zäher Verhandlungsnachmittag bevor. Kurz bevor ihm der Geduldsfaden reisst, erzielt er doch noch eine Einigung: am frühen Abend und zu einem Zeitpunkt, zu dem niemand mehr damit gerechnet hat.
Das junge Akademikerpaar streitet sich um Geld. Wer hat während der Beziehung wie viel der gemeinsamen Kosten übernommen und wie viel vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin noch zugute? Muss ein Darlehen zurückbezahlt werden? War die Frau wegen gesundheitlicher Probleme unfähig, die Tragweite einer per E-Mail abgeschlossenen Vereinbarung zu erkennen, mit der sie auf finanzielle Forderungen verzichtet und eine Restschuld von 5500 Franken anerkennt? Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Und das ehemalige Paar würdigt sich keines Blickes.
Die beiden äussern sich vor Gericht zu ihren Forderungen und bestreiten wacker die Behauptungen der Gegenseite. Sie offerieren Beweise: Zeugen, die zu befragen seien, ein neues ärztliches Gutachten, Whatsapp-Chats, E-Mails, Screenshots, und so weiter und so fort. Immer wieder kommt es zu Verhandlungsunterbrüchen, weil die eine Partei das soeben Gehörte der anderen Partei überdenken oder mit dem Rechtsvertreter besprechen muss.
Sobald alles gesagt ist, zieht Gerichtspräsident Rehm ein vorläufiges Fazit. Er gehe davon aus, dass die Beklagte dem Kläger tatsächlich noch 5500 Franken schulde. Und dass der Kläger dem Vater seiner Ex-Freundin ein Darlehen zurückzuzahlen habe. Beide Seiten haben also ein bisschen recht und ein bisschen unrecht. Darum schlägt Thomas Rehm vor, einen Vergleich zu schliessen: «Wenn Sie das Verfahren fortsetzen, wird es vermutlich ein Jahr dauern, bis ein Urteil gefällt werden kann. Was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.»
Nun fängt das Ringen um einen Vergleich an. Die beiden Parteien verziehen sich in verschiedene Ecken, ausserhalb des Gerichtssaals: der Kläger allein, nur mit telefonischer, externer Unterstützung; die Beklagte im Zwiegespräch mit dem Bruder und ihrem Anwalt. Der Gerichtspräsident pendelt zwischen den Zerstrittenen hin und her, notiert sich auf einem Schreibblock die jeweils neuen Forderungen und Zugeständnisse. Die eine willigt ein, der andere zögert und will noch ein bisschen mehr. Thomas Rehm zeigt stabile Nerven.
Kurz vor 18 Uhr kommt der Vergleich zustande und wird vom Ex-Paar sogleich unterschrieben. Er lautet folgendermassen, kurz zusammengefasst:
Klagerückzug
Beidseitige Rückzüge der Betreibungen
Die Beklagte übernimmt die Gerichtskosten.
Beide Parteien verzichten auf eine Prozessentschädigung.
Saldoklausel: Mit diesem Vergleich sind sämtliche Forderungen abgegolten.
Ende gut, alles gut? Von einem happy end zu schreiben, wäre wohl übertrieben. Das Ex-Pärchen verlässt grusslos das Gericht, kann sich immer noch nicht in die Augen schauen. Bleibt zu hoffen, dass sie den Neuanfang schaffen, den Gram, die Enttäuschung und all den Ärger hinter sich lassen. Und allfällige weitere Trennungen ohne Prozessieren gelingen.
Denn: Nicht jedes Alltagsdrama muss vor dem Richter enden.
Illustration: Till Lauer