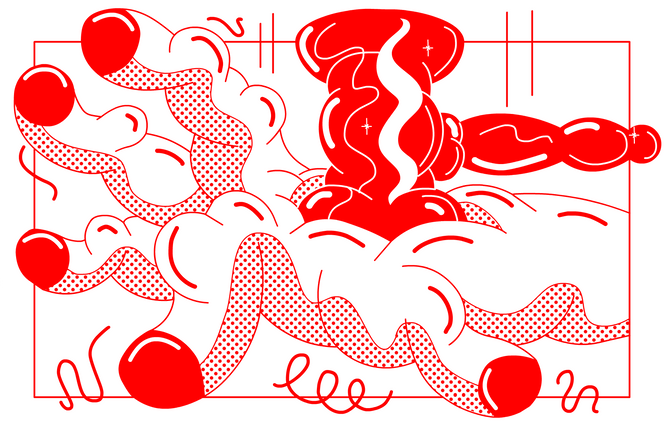
Der Sadist vom Sihlquai-Strich
Wie kaum ein anderer verkörpert er das Bild des ruchlosen Zuhälters und Menschenhändlers. Er trieb sein Unwesen am Zürcher Sihlquai – und sitzt seit elf Jahren im Gefängnis. Nun bittet er um einen Lebensabend in Freiheit.
Von Brigitte Hürlimann, 28.08.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Ort: Bezirksgericht Zürich
Zeit: 20. August 2019, 9 Uhr
Fall-Nr.: DA180003
Thema: Gesuch um bedingte Entlassung
Am 26. August 2013 wird der berüchtigte Strassenstrich am Stadtzürcher Sihlquai geschlossen und gleichzeitig der neue Strichplatz auf einer Brache in Altstetten eröffnet: mit Autoboxen, einer Rundstrecke für die Freier, einer Baracke mit Betreuungsangebot, Pausenecke, Kaffeemaschine, Dusche und Garderobe für die Prostituierten. Es handelt sich um ein schweizerisches Novum, und es ist bis heute der einzige im Land geblieben. Der Strichplatz liegt am Rande der Stadt, eingeklemmt zwischen Autobahn und Tramgleis, gut versteckt hinter Sichtschutzwänden. Es sind ganz andere Verhältnisse als damals am zentral gelegenen Sihlquai-Strich, wo jedermann rasch hingehen und ein bisschen gucken konnte.
Ob sich die Situation für die Sexarbeiterinnen mit der Schliessung verbessert hat, ist umstritten. Der Sihlquai-Strich war im In- und Ausland bekannt, er bot Stoff für Spielfilme und unzählige Medienberichte. Neugierige und potenzielle Kunden strömten in Scharen heran – und mit ihnen auch die Zuhälter- und Menschenhändlerbanden. Mit zwei gross angelegten Interventionen versuchten Polizei und Staatsanwaltschaft, den Ausbeutern das Handwerk zu legen. 2008 war es die Aktion «Goldfinger», 2010 die Aktion «Pluto». Beide Massnahmen führten zu Dutzenden von Verhaftungen und später zu Strafverfahren, Anklagen, Strafprozessen und Verurteilungen.
Der Mann, der am härtesten von allen bestraft wurde, ist heute 50 Jahre alt und schmort seit 11 Jahren im Gefängnis. Er ist den Strafverfolgern im Rahmen der «Goldfinger»-Aktion ins Netz gegangen. Der mehrfach und auch einschlägig vorbestrafte ungarische Rom wurde vom Zürcher Obergericht zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt und verwahrt: unter anderem wegen qualifizierter Vergewaltigung, gewerbsmässigen Menschenhandels, Förderung der Prostitution, Gefährdung des Lebens, Körperverletzung, Drohung, Nötigung – und so weiter und so fort.
Nur bei ihm sprachen die Richter von einem beispiellos sadistischen und grausamen Vorgehen. Er ist zum Symbolbild des skrupellosen Sihlquai-Zuhälters geworden. Der Mann drangsalierte ein halbes Dutzend Landsfrauen, schickte sie auf den Strich, liess sie schuften, nahm sie aus, quälte und bedrohte sie. Besonders schlimm ging er gegen seine damalige Freundin vor. Sie hatte am meisten unter ihm zu leiden.
Und heute bittet er also höflich um die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug. Er habe zwei Drittel seiner Strafe abgesessen und sich im Vollzug wohlverhalten, macht er geltend. Ausserdem sei er gesundheitlich angeschlagen: ein chronisches Lungenleiden, das ihn allerdings nicht vom Rauchen abhält. Die paar Jahre, die ihm noch blieben, sagt er, wolle er in Ungarn verbringen: und zwar deliktfrei, das schwöre er. In Ungarn müsse er ohnehin nochmals ins Gefängnis. Falls er dort lebend wieder rauskäme, würde er gerne ein paar letzte Jahre mit der Familie verbringen.
Der zweifache Grossvater wird in Fuss- und Handfesseln vor Gericht geführt: ein klappriger, alter Mann, der gut und gerne zwanzig Jahre älter wirkt. Er trägt einen spitzen, weissgrauen Bart, einen schwarzen Anzug und Brille, akkurat und kurz geschnittene Haare. Wüsste man nicht, wer vor einem steht, man würde ihn für einen pensionierten Papeteristen halten. Die Jahre im Gefängnis haben ihn vorzeitig altern lassen, und eben, seine Lungenkrankheit. Doch was er seinen Landsfrauen angetan hat, ist unbeschreiblich.
Dass er ein Gesuch um bedingte Entlassung stellt, ist sein gutes Recht, das ist gesetzlich so vorgesehen – auch dann, wenn zusätzlich zur Freiheitsstrafe noch eine Verwahrung angeordnet wurde. In dieser Konstellation gelten jedoch besonders strenge Voraussetzungen. Das Bundesgericht verlangt, es müsse eine «hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich der Verurteilte in der Freiheit wohlverhalten wird».
Das Verhältnis zwischen Freiheitsstrafe und Verwahrung ist eine knifflige Angelegenheit. Die Verwahrung ist keine Strafe, sondern eine Massnahme: Sie hat einen sichernden, nicht einen strafenden Zweck. Es geht darum, die Bevölkerung zu schützen und Rückfälle zu vermeiden. Darum ist bei der Verwahrung – anders als bei der Freiheitsstrafe – das Ende nicht absehbar. Es handelt sich um eine Massnahme mit open end, was für die Betroffenen schwer erträglich ist. Die Perspektive auf ein Leben ausserhalb von Gefängnismauern ist klein, denn in der Schweiz werden Verwahrte nur selten wieder in die Freiheit entlassen. Das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, der (absurde) Wunsch nach Nullrisiko im Umgang mit Straftätern, hat Vorrang.
Im Schweizer Strafrecht gilt, dass zuerst die Freiheitsstrafe verbüsst werden muss, erst dann beginnt die Verwahrung. Doch stellt sich im Laufe des Strafvollzugs heraus, dass die Voraussetzungen für eine Verwahrung nicht mehr gegeben sind (weil der Insasse nicht mehr gefährlich ist), darf sie nicht vollzogen werden. Der Sonderfall einer bedingten Entlassung, wenn gleichzeitig noch eine Verwahrung angeordnet wurde, ist in Artikel 64 Absatz 3 des Strafgesetzbuches geregelt.
Der 50-jährige Ungar beteuert vor dem Bezirksgericht Zürich, die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung seien bei ihm erfüllt. Er habe seine Lehren gezogen und keine Energie mehr für kriminelle Handlungen: «Wenn ich auch nur ein Zündhölzchen stehlen würde, ich müsste erneut mit einem strengen Urteil rechnen. Ich würde nicht mehr lebend aus dem Gefängnis kommen, darüber bin ich mir im Klaren.» Den schlimmsten Vorwurf, die qualifizierte Vergewaltigung seiner Freundin, anerkennt er bis heute nicht. Er habe es nicht getan, meint er vor Gericht, und er werde deshalb auch in fünfzig Jahren nichts anderes dazu sagen können.
Das dreiköpfige Gerichtsgremium unter dem Vorsitz von Sebastian Aeppli hört den Insassen an, hört auch den Antrag von Staatsanwalt Urs Hubmann, der von einer bedingten Entlassung des Zuhälters nichts wissen will, ebenso wenig wie das Zürcher Amt für Justizvollzug. Nach einer geheimen Beratung weisen die Richter das Gesuch ab – ein Resultat, das nicht überrascht. Es bedeute, erklärt Aeppli dem Mann, der in Fussfesseln vor ihm steht (nur die Handfesseln werden ihm während der Verhandlung abgenommen), dass er seine Strafe absitzen müsse. Das dauere bis zum 5. Dezember 2022. Danach werde geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Verwahrung noch vorlägen.
Das Gericht stützt sich bei seinem Beschluss auf zwei Expertisen: ein psychiatrisches Gutachten von Elmar Habermeyer und eine Stellungnahme der Fachkommission des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats. Der Gutachter diagnostiziert beim Zuhälter eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Merkmalen. Er übernehme keine Verantwortung, zeichne sich durch einen Empathiemangel aus, tendiere zu Bagatellisierung und Externalisierung. Aktuell, so Habermeyer, bestehe keine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Mann in Freiheit wohlverhalten werde. Vielmehr sei damit zu rechnen, dass er seine früheren Aktivitäten im kriminellen Milieu wieder aufnehme, nicht zuletzt, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.
Gleich pessimistisch fällt die Stellungnahme der Fachkommission aus. Sie hält fest, dass der Rom früh mit dem Delinquieren begonnen habe, zusammen mit anderen Familienmitgliedern, und dass die Kriminalität als ein eingeschliffenes Verhaltensmuster bezeichnet werden müsse. Gezweifelt wird allenthalben auch an der Reue und Einsicht des Verurteilten. Nur ein knappes Jahr lang hat er Zahlungen an die Opferhilfe geleistet – zwanzig Franken pro Monat – und diese dann wieder eingestellt.
Der amtliche Verteidiger, Johannes Helbling, versucht vergebens, die beiden Expertisen zu entkräften. Er betont, dass nicht eine zeitnahe Entlassung zur Diskussion stehe, sondern die Auslieferung nach Ungarn, wo der Mann eine mehrjährige Freiheitsstrafe abzusitzen habe. Es werde wohl noch zehn Jahre dauern, bis er tatsächlich in die Freiheit komme, dann sei er ein alter Mann und nicht mehr rückfallgefährdet. Es seien seinem Mandanten noch ein paar Lebensjahre im Kreise der Familie zu gönnen.
In der ersten Prozessrunde unterliegt der Verteidiger mit seinem Antrag. Doch er wird den Beschluss des Bezirksgerichts an die nächste Instanz, ans Obergericht, ziehen. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen, die Ereignisse rund um den Sihlquai-Strich werden die Gerichte weiterhin beschäftigen. So schnell wird man diese Episode nicht ad acta legen können. Auch wenn am Sihlquai seit sechs Jahren nichts, aber rein gar nichts mehr an die damaligen Zeiten erinnert.
Illustration Friederike Hantel