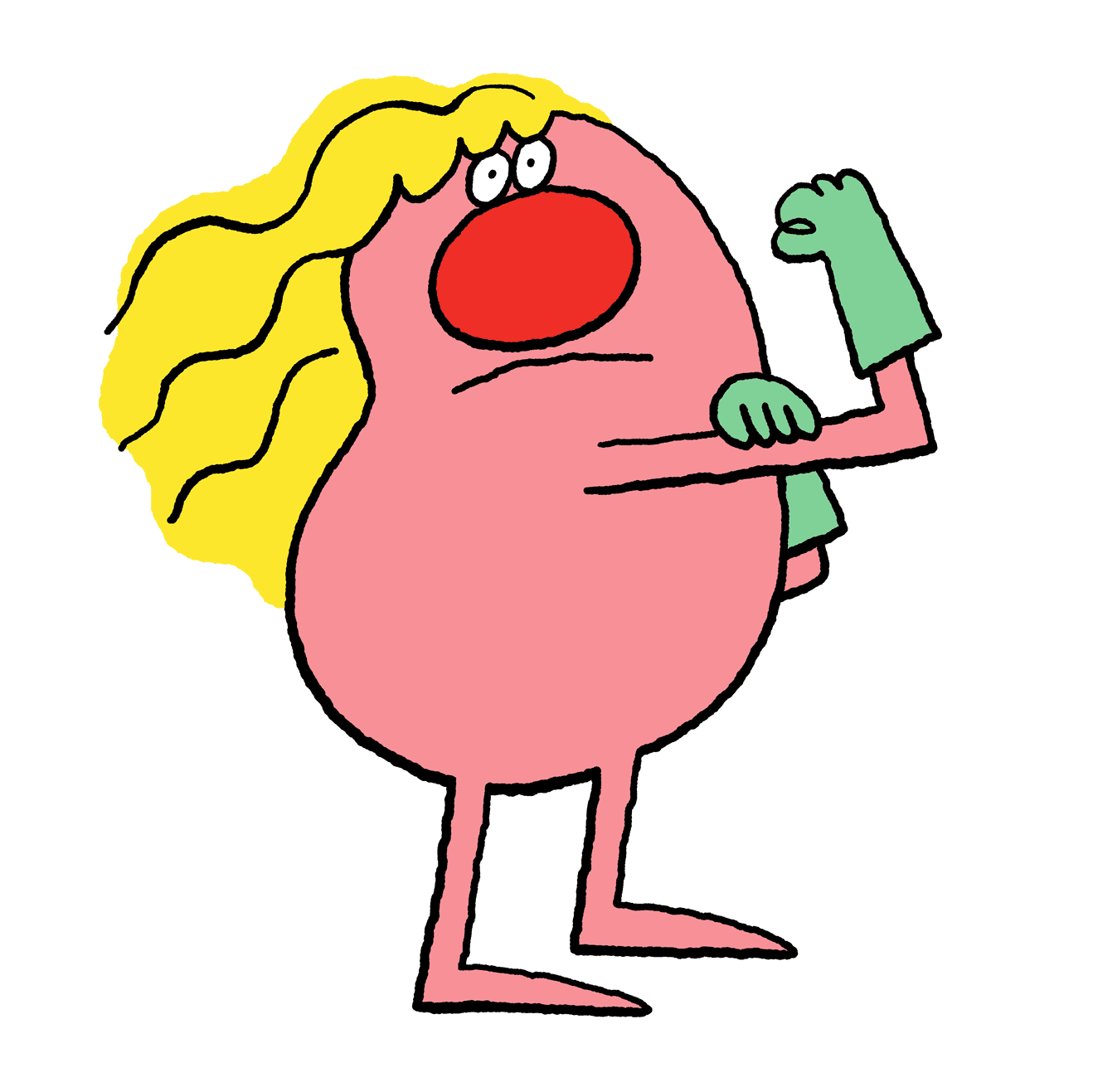
Mit Gleitgel gegen das Patriarchat
Unsere Autorin ist den Boys Club leid. Sie beschliesst, in ihn einzudringen. Mit einem Plastikpenis.
Von Solmaz Khorsand (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 09.01.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Der After eines Mannes ist der Anfang vom Ende. Um genau zu sein: zwei Finger im After eines Mannes. So beginnt der Sturz des Patriarchats. In Latexhandschuhen, langsam und glitschig.
Wie man an einem verregneten Sonntagnachmittag im After eines fremden Mannes landet?
Mit einer Frage: Wie sprengt Frau den Boys Club?
Jede Frau stellt sich diese Frage irgendwann. Sei es zu Hause, wenn der Mitbewohner seine Kumpel zum Abendessen einlädt, sei es beim Glas Wein am Wochenende in der Runde der progressiven Grafiker, sei es im Büro bei der allwöchentlichen Montagskonferenz.
Irgendwann sitzt Frau allein in einer dieser Männerrunden. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem sie sich als Zuschauerin eines Tierfilms wähnt. Dann, wenn das Gerangel losgeht. Wer hat was zu melden. Wer führt. Und wer kuscht. Brustkörbe blähen sich, Stimmen werden lauter, Beine breiter. Und die Wortmeldungen zunehmend irrelevanter, bis sie dem Geschwafel dementer Rentner gleichen, die das Gesagte ihrer Vorredner in Endlosschleife wiederholen.
Soziologisch lässt sich das ganz einfach erklären: mit Pierre Bourdieu. In seinem Aufsatz über die männliche Herrschaft erklärt der französische Soziologe, dass sich der männliche Habitus in homosozialen Räumen konstruiert, wo sich Männer untereinander messen. Sie sind angetrieben von der libido dominandi, dem Wunsch, andere Männer zu dominieren. Erst durch die Anerkennung anderer Männer wird sich der Mann seiner eigenen Männlichkeit gewahr. Und wie er sie bekommt? Im Wettbewerb. Frau ist in diesem Spiel nur eines: Zuschauerin. Ihre Rolle ist die eines «schmeichelnden Spiegels», wie Bourdieu die Autorin Virginia Woolf zitiert. Sie soll dem Mann lediglich «das vergrösserte Bild» seiner selbst zurückwerfen.
Doch was, wenn sich Frau weigert, ein schmeichelnder Spiegel zu sein? Was, wenn sie die Rituale männlicher Selbstvergewisserung satthat? Was, wenn sie keine Lust hat, von der Seitenlinie aus den Boys beim Spielen und damit letzten Endes beim Machen zuzusehen?
Sie sucht Antworten auf ihre Frage. Die erste Anlaufstelle: die Macherinnen. Eine ganze Industrie hat sich darauf spezialisiert, Frauen zu «helfen», wie sie sich in der «Männerwelt» durchsetzen. Ehemalige Managerinnen schreiben Ratgeber um Ratgeber, um ihren Geschlechtsgenossinnen die Codes dieser homosozialen Räume zu entziffern. In Seminaren und teuren Privatstunden erklären sie den lernbegierigen Frauen dann, dass sie diese Territorien wie fremde Länder angehen sollen. Um sich darin souverän zu bewegen, müssten sie nur die Fremdsprache dieser Länder lernen.
«Hierarchisch» sollen sie kommunizieren, so wie die Männer, nicht in Netzwerken, wie Frau es gewohnt ist. So muss das Wort immer an das höchste Glied der Kette gerichtet werden. Ihm muss der pitch gemacht werden, ihm darf zugestimmt werden, ihm muss imponiert werden. Ihm, nur ihm. Mutig sollen Frauen dabei sein, mit lautem Organ, und wenn möglich ihre piepsigen Stimmen auf eine Stufe einige Oktaven tiefer trainieren. Raumeinnehmend sollen sie sich an den Konferenztisch setzen, in jede Atempause ihrer Kollegen reingrätschen, ihre Demenzrhetorik imitieren und ebenso Gesagtes um Worthülsen ergänzen, nur um auch gesprochen zu haben.
Beleidigt, verletzt oder autoritär darf Frau dabei nie rüberkommen. Immer gelassen, immer entspannt. Ruhig darf sie dabei noch Frau sein, könne gar mit der richtigen Camouflage das andere Geschlecht aus dem Konzept bringen, mit ein paar Signalfarben betören und mit Männerparfüm sensorisch dermassen verwirren, dass sie gar als einer der Boys wahrgenommen wird.
Eier legende Wollmilchfrau
Tiermetaphern sind in dieser Welt ein beliebter Referenzrahmen. Es ist viel die Rede von Silberrücken und Leitwölfen. Sonja Buholzer orientiert sich an Haien. In ihrem Büro im Stadthof, einem edlen Gebäudekomplex unmittelbar gegenüber vom Zürcher Hauptbahnhof, blickt sie von ihrem Schreibtisch aus jeden Tag in das Gesicht eines Haies. An der Wand hängt ein Foto, das sie bei einem ihrer Tauchgänge gemacht hat. Buholzer hat jahrelang als Managerin und Mitglied der Direktion bei der UBS gearbeitet. Heute berät sie Manager und Politiker. Ausserdem ist sie Autorin zahlreicher Bücher mit Titeln wie «Die Frau im Haifischbecken – Was wir vom ‹Topräuber› der Meere lernen können» und «Woman Power – Karriere machen, Frau sein».
In ihren Büchern beschwört Buholzer die Eier legende Wollmilchfrau: Spitzenleistung soll sie bringen, dezent attraktiv sein, empathisch, unberechenbar, immer auf der Hut, niemals den Eindruck erwecken, selbst eine Gefahr darzustellen, sich nicht verbiegen, den Planeten im Auge haben und dabei immer Vollblutfrau sein, denn «wer nicht geniessen kann, wird ungeniessbar, wer sich selbst nicht lieben kann, bleibt im Club der Ungeküssten».
Und wie crasht diese geküsste, Eier legende Wollmilchfrau den Boys Club?
Buholzer schaut streng. Mit den blonden, schulterlangen Haaren und den blauen Augen sieht sie aus wie die schlankere Version der französischen Politikerin Marine Le Pen. Ihr zotteliger Windhund zieht seine Runden im Büro. Mit Kampfrhetorik kann Buholzer wenig anfangen. Wer die Probleme im Kampf lösen wolle, greife zu kurz: «Wenn jemand diese Haltung hat, ist es besser, wenn diese Person gar keine Karriere anpeilt, weil das nur im Burn-out endet, im Kampf und in der Frustration», sagt sie. Fragen müsste die Frau stellen, klug, mutig und souverän. Es gehe um den Wettbewerb, nicht um den Wettkampf. «Das ist kein Kampf», betont sie, «das ist eine Riesenchance für beide Geschlechter für ein authentisch geprägtes Miteinander, das beide individuell definieren.» So, wie ein fremdes Land zu erkunden, eine Fremdsprache zu erlernen, auch miteinander, statt sich mit alten Vorurteilen zu bekämpfen.
Wenn das geglückt ist, könne man das Spiel bestimmen. Den Spiess umdrehen und alles anders machen. Bis dahin heisst es den Duden auspacken und die Fremdsprache pauken.
Es ist eine deprimierende Odyssee. Vom Rhetorik-Guru bis zum Militärstrategen, sie alle geben die gleichen Ratschläge: den Boys Club wie ein Spiel sehen, und wenn der Schuh drückt, einfach die Dinge ansprechen. Frau wird sich wundern, wie sehr das Mann entwaffnet, wenn er auf Missstände angesprochen wird: Warum er ihr denn ihre eigene Expertise erklären will, warum er nur die Kollegen anschaut, wenn es um Sachthemen geht, und nie die Kolleginnen, warum der Vorschlag der Kollegin überhört wird und derselbe Vorschlag von einem Kollegen lang und breit diskutiert.
Hat man es denn schon mit Ansprechen probiert? Hatte man den Mut, sich dermassen zu exponieren?
Ja, verdammt.
Schliesslich herrschen ja noch keine Zustände wie in Margaret Atwoods Dystopie «The Handmaid’s Tale», wo Frauen in fruchtbare und unfruchtbare Brutkästen eingeteilt werden, die bei jedem Widerspruch damit rechnen müssen, dass ihnen Gliedmassen amputiert werden.
Wir kriegen schon den Mund auf, keine Sorge. Unsere Generation hat den Spruch «if you see something, say something» längst aus dem Terrorkontext in den Alltag transferiert. Doch es ödet uns an. Es ist ermüdend und zermürbend, immer und überall diejenige zu sein, die Dinge anspricht, wieder einmal zu bedenken gibt, klug, souverän und mutig hinterfragt. Wir sind es leid. Schliesslich wollen wir uns ja auf das Eigentliche konzentrieren: unseren Job.
Aber gut, nehmen wir die wohlgemeinten Ratschläge, in denen Männer die Norm und Frauen die Abweichlerinnen sind, ernst. Lernen wir die Sprache dieses Territoriums, auf dem wir offenbar nur Fremde sind. Nehmen wir die männliche Perspektive ein.
Wer die Position im Bett ändert, ändert sie überall
Maggie Tapert zeigt, wie. Sie bietet den ultimativen Perspektivenwechsel an.
«Behandelt die Männer wie Objekte. Sie sollen diese Erfahrung auch einmal machen», sagt sie und lacht. Und so landet man an einem Sonntag mit Latexhandschuhen und Gleitgel in einem Yogastudio an der Langstrasse in Zürich.
Draussen regnet es, drinnen haben sich zwölf Frauen auf Yogamatten und Decken um Maggie Tapert versammelt. Wir lächeln einander zu, offen und ein bisschen verschwörerisch. Wir wissen, hier wird heute etwas passieren, was die eigene Welt auf den Kopf stellt. Tapert, 73, schwarze Baumwollhose, schwarzer Pulli, kurze, weisse Haare und verstopfte Nase, steht in der Mitte des Raumes wie ein verschnupfter Yoda.
Alle drei Monate versammelt sie eine Gruppe von Frauen um sich. In ihrem Workshop «Place of Power» will die Sexualerzieherin, wie sich Tapert selbst bezeichnet, Frauen «ermächtigen». Seit über 25 Jahren bringt die gebürtige New Yorkerin Frauen in der Schweiz bei, wie sie zum Orgasmus kommen. Seit knapp einem Jahr hat sie ihre Mission um eine Etappe erweitert. Sie will ihnen die Kontrolle im Schlafzimmer übergeben. Denn wer die Kontrolle im Schlafzimmer hat, hat sie auch im Leben. «Frauen sind überall stark und selbstbewusst, aber in der Minute, wo sie ins Schlafzimmer treten, fallen sie zurück in die Fünfzigerjahre. Sie werden zu diesen unschuldigen Prinzessinnen, die nicht wissen, was sie wollen, und hoffen, dass der Mann schon weiss, was zu tun ist», erklärt sie. «Wenn wir die Position der Frau im Schlafzimmer ändern, ändert sich alles.»
An ihrer Assistentin führt sie vor, wie Frau dominanter auftritt. Sie befiehlt ihr, sich auszuziehen, während Tapert selbst voll bekleidet vor ihr steht. Ruhig legt sie ihr ein Hundehalsband an, zwingt sie mit einem Befehl auf die Knie und schlägt ihr dann mit der flachen Hand auf den Hintern. Dabei erklärt sie, wie man richtig das Fleisch anvisiert, um nicht aus Versehen den Knochen zu treffen. Es soll ja niemand verletzt werden. Wer will, dass es schön klatscht, soll seine Hand wölben. Die Assistentin stöhnt unter den Schlägen. Ihr gefällt die Tracht Prügel. Danach dankt ihr Tapert. Auch das ist Teil der Zeremonie. Es ist ein Spiel, von dem beide etwas haben sollen.
Dann kommen die Frauen dran. Sie sollen aneinander üben, sich einmal warmlaufen, wie es ist, jemanden zu dominieren. Sie ziehen einander am Hundehalsband durch den Raum, einige bekleidet, andere nackt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Was Spass macht, ist erlaubt. Keine soll zu etwas genötigt werden.
Das ist die Trockenübung.
Der Perspektivenwechsel beginnt am Nachmittag. Dann, wenn die Männer kommen.
Die Objekte.
Sechs Männer führt Maggie Tapert in den Raum. Sie tragen schwarze Unterhosen und schwarze Stoffmasken über dem Kopf. Augen, Nase und Mund sind frei. Sie können die Frauen sehen, doch ihre Anonymität ist gewahrt. Wie eine kleine Herde Vieh stehen sie im Kreis von Frauen. Es sind junge, schlanke, heterosexuelle Männer, die alle drei Monate hier ihren kink ausleben können, von dominanten Frauen in spe gezüchtigt zu werden.
Nach einem kurzen Dankesgebet für ihren kommenden Einsatz weist Tapert jedem Frauenpaar einen Mann zu. Austoben sollen sich die Frauen an ihnen. Mit den Utensilien, die sie mitgebracht haben, dem Hundehalsband, den Reitgerten und ausgefransten Peitschen. Sie können die Männer mit Seilen fesseln, sie an der Leine führen, ihnen ihre Brüste in den Mund stecken und sie mit Dildos penetrieren. Sie können mit ihnen machen, was sie wollen. Die Männer dürfen lediglich Ja, Nein und Stopp sagen. Mehr Kommunikation ist nicht. Tapert will verhindern, dass die Teilnehmerinnen in alte Muster zurückfallen und am Ende die «Objekte» noch fragen, was ihnen gefällt und ob es sich gut anfühlt, wenn die Hoden abgeklemmt werden, statt zu schauen, wonach ihnen selbst ist.
Wie erektionsgestörte Pandas
Mach mit ihm, was du willst, lautet die Order. Neugierig schaue ich in die warmen, lachenden Augen, die mich hinter der Maske anblinzeln. Süss ist er. Ich grinse ihn an. Vorsichtig lege ich das Hundehalsband an. Nach Schlagen ist mir nicht. Eher nach Berühren, Kneten, ein bisschen Beissen. Das Verbotene zu lüften, an der Maske, die nach Waschmittel riecht, herumzuzupfen, zu erfahren, wer sich dahinter verbirgt. Tadel gibt es dafür. «Ich habe gesehen, wie du in alte Muster zurückfällst», sagt Tapert streng.
Die Partnerin stellt sich besser an. Sie befiehlt ihm, dem «Objekt», den Blick zu senken, und beginnt langsam mit einem Schnürchen die Hoden wie ein Geschenkpaket abzubinden. Danach fährt sie mit ihren Seilen langsam seinen Rücken entlang, schlägt leicht zu, während er mit halb erigiertem Penis vor mir steht.
Bei aller Wut über das System, das Patriarchat und den affenähnlichen Boys Club – mein Bedürfnis, einem Mann mit Wäscheklammern die Brustwarzen abzuklemmen und seine Hoden wie einen Erntedank-Truthahn zu drapieren, hält sich in Grenzen. Das Konzept «Dominanz durch Erniedrigung» erschliesst sich mir nicht. Schon gar nicht als Lustgewinn. Weder aktiv noch passiv.
Doch in mir hallt der Schrei einer Freundin nach. «Ich will ihn ficken!», brüllt sie immer, wenn sie wütend ist, wenn sie ein Mann wieder einmal nicht ernst genommen hat, ihr nicht zuhört, ihr die Expertise abspricht. «Ich will ihn ficken!» ist ihre Kampfansage, ihr Dominanzlingo. Linguisten bezeichnen das als Versuch, die männliche Sprache zu kopieren. Wie bei jeglichem Dominanzgebaren von Frauen scheint es sich auch hier lediglich um die Imitation des Männlichen zu handeln. Schliesslich fickt Mann, Frau wird nur gefickt.
Doch Tapert zeigt vor, wie es anders geht. Sanft, mit viel Gleitgel, steckt sie einen Finger in den After eines Vorzeigemannes, fühlt langsam vor, massiert ihn und versucht so, ihn sachte zu öffnen. Dann den zweiten Finger. Mit viel Geduld kann man mit der Prozedur so lange weitermachen, bis alles Mögliche da reinpasst, vom Dildo bis zur ganzen Faust. «Männer penetrieren Frauen ihr ganzes Leben lang und haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Wenn ein Mann das erste Mal penetriert wird, versteht er die Welt ganz anders. Das ist gut für Männer und für Frauen», predigt Tapert.
Nun gut, probieren wir das einmal. Mit geborgtem Geschirr und hautfarbenem Plastikpenis nähere ich mich unserem Objekt. Zu gross ist der Gürtel, zu schmal mein Becken. Schlaff hängt der Plastikpenis zwischen meinen Beinen. Fast schon zu realistisch.
Die Kollegin hat unser Objekt schon einmal vorbereitet. Wir lächeln einander zu. An der Brust mit Seilen umschnürt, kniet er auf allen vieren auf der Matte. Sie reicht mir die Latexhandschuhe und das Gleitgel. Vorsichtig führe ich den ersten Finger ein, spüre Widerstand. Ich warte. Dann massiere ich, wie Tapert es vorgemacht hat. Neugierig mache ich weiter. Erotisch fühlt es sich nicht an, eher klinisch, so muss sich eine Ärztin bei der Rektaluntersuchung fühlen.
Unser Objekt stöhnt.
Nun scheint der Anus weit genug geöffnet zu sein. Ich gehe hinter ihm in die Hocke und schaue besorgt auf das träge Plastikteil. Wie soll das da rein? Die Schenkel vibrieren, zu klein und ungelenk bin ich, um mich im richtigen Winkel hinter meinem 80-Kilo-Mann zu platzieren. Wir drehen ihn um. Wie ein eingeschnürter Käfer auf dem Gynäkologenstuhl liegt er nun vor mir. Die Kollegin steckt ihm die Hand in den Mund, an der er lutscht, während ich zwischen seinen Beinen wie ein Ingenieur immer noch hilflos versuche, das Schlaffe ins Glitschige zu bringen.
Wir brüllen vor Lachen, alle drei. Es ist ein einziger Zirkusakt. Wie ein erektionsgestörtes Pandapaar bei einem demotivierten Kopulationsversuch sehen wir aus.
Irgendwann erbarmt sich Maggie Tapert und hilft nach. Der Dildo ist drinnen. «Jetzt bloss nicht wie die Männer das Ding einfach so reinrammen, sondern langsam. Achte auf seine Atmung», mahnt sie. Erschöpft lege ich mich auf seine Brust und mache kurz Pause. Dann schiebe ich in gefühlter Zeitlupe das Becken vor und zurück, spreize seine Beine, schaue, wie sich die Brust hebt und senkt. Mein Panda stöhnt. Schweiss tropft mir von der Stirn. Irgendwann habe ich den Dreh raus. Wir haben einen Rhythmus, wie bei einer Choreografie, die man schon einmal gemacht hat – nur eben seitenverkehrt.
Es macht Spass. Und ist spannend. Aber fühle ich mich ermächtigt? Ist es so viel dominanter, zu penetrieren, als penetriert zu werden? Wer hat die Deutungshoheit über diese Interpretation?
Ich bin verwirrt. Ich habe mich vor diesem Sonntag nicht sonderlich passiver gefühlt, und jetzt nicht viel aktiver. Aber ich bin um eine Erfahrung reicher. Ich weiss nun, wie sich ein Teenagerjunge bei der Entjungferung fühlt. Gestresst, motorisch nicht ganz im Einklang mit Geist und Körper und in permanenter Panik, etwas kaputtzumachen.
Dankbar umarmen meine Partnerin und ich unser Objekt am Ende des Workshops. In drei Monaten findet er wieder statt. Bis dahin steht das Patriarchat mit aller Wahrscheinlichkeit noch. Ob wir dann schon die Sprache des uns fremden Territoriums beherrschen?
Die Latexhandschuhe und das Gleitgel sind schon einmal eingepackt. Nur zur Sicherheit.