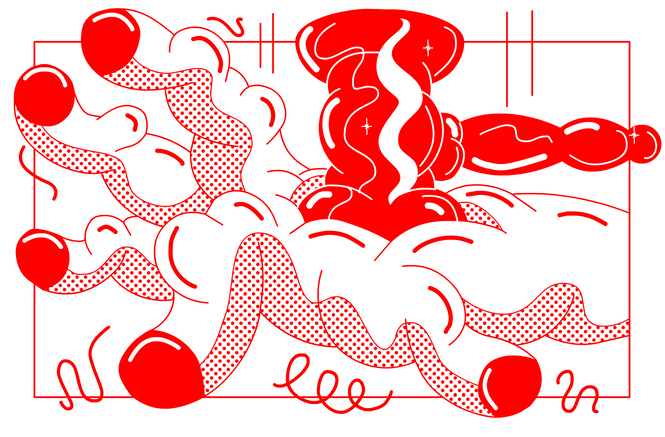
Wenn die Staatsanwältin auf Freispruch plädiert
Vor bald zehn Jahren kam es im Baselbiet bei einer Verkehrskontrolle zu einer Schiesserei. Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines Polizisten aufgehoben – und weist die Staatsanwältin für die zweite Runde vom Platz.
Von Markus Felber, 05.12.2018
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Ort: Lausanne
Zeit: 10. September 2018
Urteilsreferenz: 6B_719/2017
Thema: Fahrlässige Körperverletzung
Was genau passiert ist am 9. August 2009 irgendwo auf der A 2 im Baselbiet, steht noch nicht mit Sicherheit fest, da das Bundesgericht den Fall zur Neubeurteilung nach Liestal zurückgewiesen hat. Bei seinem ersten Entscheid war das Kantonsgericht Basel-Landschaft von folgendem filmreifem Sachverhalt ausgegangen:
Zwei Polizeibeamte sind in einem Zivilfahrzeug unterwegs, als das vor ihnen fahrende Auto stark beschleunigt. Sie lösen eine Geschwindigkeitsmessung aus, geben sich anschliessend als Ordnungshüter zu erkennen und fordern den vor ihnen fahrenden Lenker mehrmals auf, anzuhalten. Der fährt jedoch weiter, und erst nach einer längeren Verfolgungsfahrt gelingt es der Polizei, das Auto zu überholen und zu stoppen.
Trotz der Aufforderung auszusteigen bleibt der Lenker sitzen und hält sich am Lenkrad fest. Als ihn die Beamten aus dem Wagen ziehen wollen, kommt es zu einem Gerangel, bei dem einem der beiden Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster fällt. Der Autolenker ergreift die Pistole und gibt daraus drei Schüsse ab. Trotzdem vermag der Beamte seine Waffe wieder zu behändigen. Er begibt sich hinter das Auto, um eine Ladestörung zu beheben.
Unterdessen schnappt sich der Lenker den Pfefferspray des zweiten Polizisten, der in der Folge um Hilfe schreit. Sein Kollege eilt mit der inzwischen wieder funktionstüchtigen Waffe zu Hilfe und schiesst dem Autolenker gezielt in den Unterschenkel. Der Getroffene wehrt sich auch nach der Schussabgabe massiv gegen die Polizisten, bis er schliesslich überwältigt werden kann. Er wird dafür wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens verurteilt.
Urteil nach Zusatz-Anklageschrift
Gegen den Polizeibeamten erhob die Staatsanwaltschaft aufgrund des Waffeneinsatzes zwar Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 und 2 Abs. 1 Strafgesetzbuch), beantragte aber einen Freispruch. Der Präsident des erstinstanzlich zuständigen Baselbieter Strafgerichts gab der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage abzuändern. Es könne auch eine bloss fahrlässige Körperverletzung sowie Amtsmissbrauch vorliegen, und dazu enthalte die Anklageschrift nicht genügend Elemente.
In der Folge reichte die Staatsanwaltschaft zum Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung eine Zusatz-Anklageschrift ein. Sie verzichtete aber auf eine Ergänzung in Bezug auf Amtsmissbrauch, da dieser Straftatbestand für die zuständige Staatsanwältin klarerweise nicht erfüllt ist.
Das Strafgericht verurteilte den angeklagten Polizeibeamten schliesslich wegen fahrlässiger Körperverletzung (Art. 125 Abs. 1 Strafgesetzbuch) zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 110 Franken. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft wies eine dagegen gerichtete Berufung ab und bestätigte das erstinstanzliche Urteil in allen Punkten.
Das Verdikt aus Lausanne
Das vom Verurteilten angerufene Bundesgericht indes hob den Schuldspruch auf, weil es den Anklagegrundsatz verletzt sieht. Dabei handelt es sich um ein ziemlich komplexes Verfahrensprinzip, mit dem nicht nur Jusstudenten ihre liebe Mühe haben, sondern immer wieder auch gestandene Richter – ab und zu sogar auf höchster Ebene.
Der Anklagegrundsatz – auch Akkusationsprinzip genannt – umgrenzt den Prozessgegenstand. Das Gericht darf den Beschuldigten nur für die in der Anklageschrift erwähnten Handlungen verurteilen, kann diese Vorgänge allerdings rechtlich anders beurteilen, als die Staatsanwaltschaft das tut.
Damit sollen die Verteidigungsrechte und der Anspruch auf rechtliches Gehör geschützt werden. Der Angeklagte muss rechtzeitig wissen, welche konkreten Handlungen ihm die Strafverfolgungsbehörde vorwirft und wie sie diese rechtlich würdigt. Er darf mit anderen Worten nicht erst an der Gerichtsverhandlung mit ihm bisher unbekannten Anschuldigungen konfrontiert werden.
Genau das aber ist nach Einschätzung des Bundesgerichts geschehen. Laut der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Anklageergänzung ging der angeklagte Polizeibeamte bei der Schussabgabe davon aus, dass sich sein Kollege in unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben befand. Vorgeworfen wird ihm einzig, dass er bei genügender Sorgfalt hätte merken müssen, dass keine eigentliche Notwehrhilfelage bestand. Welche konkrete Sorgfaltspflicht der Beschuldigte missachtet haben soll, ergibt sich aus dem Text der Anklageergänzung nicht. Das Kantonsgericht dagegen wirft dem Verurteilten in der Begründung des Schuldspruchs konkret vor, er habe sich über die «geltenden gesetzlichen Vorschriften und die sich daraus ergebenden Pflichten» hinweggesetzt.
Damit hat das Kantonsgericht laut dem Urteil aus Lausanne den effektiven Anklagetext überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, sondern «ungeprüft die falsche Anklagewiedergabe der Erstinstanz» übernommen. Was für unbefangene Leser nach juristischer Haarspalterei aussehen mag, hat eine drastische Konsequenz: Das Verdikt wurde aufgehoben und die Sache ans Kantonsgericht zurückgewiesen.
Die Sache mit der Staatsanwältin
Hätte es damit sein Bewenden, müsste der Polizeibeamte wohl aufgrund der ungenügenden Anklageschrift freigesprochen werden. Das Bundesgericht fügt nun aber, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, seinem Urteil ein zweites Begründungskapitel hinzu. Damit strafen die Bundesrichter Christian Denys und Niklaus Oberholzer sowie die nebenamtliche Richterin Yvona Griesser das Bonmot Lügen, laut dem es ohne Kläger keine Richter gibt. Denn gewissermassen von Amtes wegen wirft das Gericht mit Blick auf das Vorgehen der zuständigen Staatsanwältin die Frage nach deren Unbefangenheit auf.
Das Verfahren gegen den Beamten war zunächst einmal dreieinhalb Jahre nach der verhängnisvollen Polizeikontrolle eingestellt worden, weil die Staatsanwältin den Schusswaffengebrauch für rechtmässig hielt. Das Baselbieter Kantonsgericht beanstandete die Verfahrenseinstellung und bestand auf einer Anklage. Eine solche reichte die Staatsanwaltschaft dann wie erwähnt beim Strafgericht auch ein, beantragte aber einen Freispruch. Und die in der Folge vom Gerichtspräsidenten angeregte Ergänzung der Anklage enthielt weder Ausführungen zur Frage des Amtsmissbrauchs noch dazu, ob der Polizist eine allfällige Nothilfelage vor der Schussabgabe geprüft hat.
Aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände entsteht aus Sicht des Bundesgerichts «in objektiv begründeter Weise der Eindruck», die Staatsanwältin habe dem im Raum stehenden Vorwurf einer fahrlässigen Körperverletzung zunächst gar nicht nachgehen wollen und in einer zweiten Phase derart offensichtlich fehlerhaft und widerwillig Anklage erhoben, dass das Gericht den Polizeibeamten gar nicht verurteilen konnte, ohne den Anklagegrundsatz zu verletzen.
Darum hob das Bundesgericht die Verurteilung des Polizeibeamten nicht nur wegen Missachtung des Akkusationsprinzips auf, sondern zusätzlich auch deshalb, weil eine befangene Staatsanwältin mitgewirkt hatte. Damit kommt es bald zehn Jahre nach dem Vorfall auf der Autobahn zu einer neuen gerichtlichen Beurteilung, deren Ausgang völlig offen ist, weil die Anklage von einer anderen Person vertreten werden muss.
Illustration: Friedrike Hantel