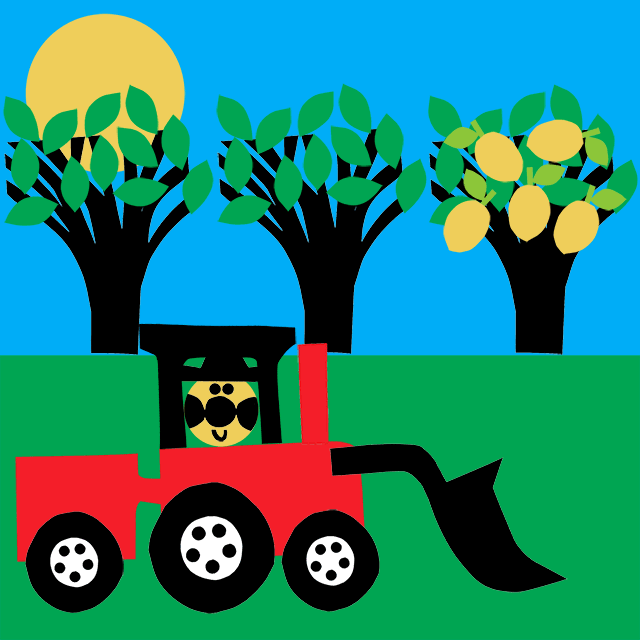
Das Land, wo bald die Zitronen blühn
Die Schweiz wird zu einem mediterranen Land, nur leider ohne Meer. Für die Landwirtschaft ein Glück: Es werden Melonen, Reis und Topweine wachsen. Doch den Bauern fällt die Umstellung schwer, die der Klimawandel verlangt.
Von Urs Bruderer (Text) und Adam Higton (Illustrationen), 07.09.2018
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Ausgerechnet die Kartoffel. Wo doch die Geschwellten zum Raclette gehören wie der Kirsch zum Fondue. Der Kartoffel wird es unwohl in der Schweiz. Sie gehört zu den Verliererinnen des Klimawandels.
Sie mag es nicht heiss, im Anbau verlangt sie viel Wasser und im Winter einen rechten Frost – Bedingungen, die selten werden hierzulande. Taucht keine Neuzüchtung auf, könnte die Kartoffel wieder zu dem werden, was sie war, als sie vor rund vierhundert Jahren in die Schweiz gelangte: eine wegen ihrer schönen Blüte geschätzte Zierpflanze.
Oder sie bleibt, tauscht aber im Regal den Platz mit der Süsskartoffel, die heute noch neben Papaya und Kumquat liegt, also bei den Exoten. Agroscope, die landwirtschaftliche Forschungsstelle des Bundes, hat Versuche durchgeführt und legt den Bauern die längliche Tropenknolle ans Herz, denn sie gedeiht gut und bringt satte Einnahmen.
Lehrreiche Wetterextreme
Wo Verlierer sind, sind auch Gewinner, nicht nur beim Gemüse. Die Schweizer Bauern könnten zu den Gewinnern des Klimawandels gehören. Ihre südeuropäischen Kollegen kämpfen in ein paar Jahrzehnten mit nordafrikanischen Verhältnissen, mit Dürre und Erosion. In der Schweiz hingegen bedeuten wärmere Temperaturen längere Vegetationsperioden, und die lassen sich ausnutzen.
Doch statt neue Chancen auszuloten, haben viele Bauern den Klimawandel lange verdrängt. Unterstützt hat sie dabei die einstige Bauernpartei SVP, die den Klimawandel auch in ihrem aktuellen Programm kein einziges Mal erwähnt und stattdessen von «grünen Ideologen und Umwelttheoretikern» spricht, die «mit dauernder Schwarzmalerei den Leuten ein schlechtes Gewissen» einreden wollten.
Doch die Wetterextreme der letzten Jahre lassen die Bauern umdenken:
2014: ein völlig verregneter Sommer
2015: ein Rekordhitzejahr
2016: fast kein Schnee
2017: der verheerende Aprilfrost
2018: ein sehr heisser, sehr trockener Sommer
Für Bauern, die sich nicht verändern wollen, gibt es keinen Grund mehr, sich keine Sorgen zu machen.
Kamele statt Kühe
Zwischen den frei laufenden Kühen im Stall von Thomas Boltshauser dreht ein Roboter still seine Runden und schiebt den Mist weg. Die Tiere interessiert das dunkelgrüne Futter: Mais, und das schon Ende August. «Die Vegetation ist einen ganzen Monat voraus», sagt der Bauer aus dem thurgauischen Ottoberg. Sein Hof ist so aufgeräumt wie der Schreibtisch der Königin von England, und er strahlt dieselbe zufriedene Leistungsfähigkeit aus wie seine Milchkühe. In normalen Jahren verfüttert er ihnen nur die Maiskolben, dieses Jahr hat er auch Stiele und Blätter verhäckselt. Die Trockenheit hat zu grossen Ausfällen in der Grasernte geführt: «Uns fehlt ein ganzer Schnitt oder anderthalb», sagt Boltshauser. In normalen Jahren – wenn es so etwas noch gibt – mäht er seine Wiesen fünfmal. Dieses Jahr viermal, und der letzte Schnitt wird mager.
Andere Bauern mussten deshalb Futter zukaufen, Boltshauser nicht. Er hat Vorräte vom letzten Jahr. «Aber noch so ein Sommer, und es wird auch bei mir eng.»
Auf dem Kalenderblatt in der Küche fährt ein riesiger Mähdrescher unter einem hohen blauen Himmel über ein endloses Feld. In den sanften Hügelzügen des Thurgaus geht Landwirtschaft anders. Thomas Boltshauser sitzt am runden Holztisch und gerät ins Grübeln. «Wir wirtschaften hier in zehnter Generation. Auch früher gab es harte Zeiten, das ist dokumentiert. Aber immer hatten die Boltshausers Vieh und Obst.»
Und seine Enkel, werden die noch Kühe halten?
«Da bin ich mir nicht sicher.»
Wenn heisse, trockene Sommer die Regel werden, sieht er nur schlechte Optionen. Entweder pachtet er mehr Land (und arbeitet mehr), oder er bewässert (und arbeitet auch noch nachts), oder er kauft Futter dazu. Nur: woher? Im Sommer flog Boltshauser nach Berlin. Der Blick aus dem Flugzeugfenster sei brutal gewesen: «Riesige braune Flächen, viel schlimmer noch als hier. Und nicht nur Deutschland, auch Schweden und Dänemark litten unter Trockenheit. Und alle haben selber Tiere.»
Das für Milchkühe nötige Futter wird knapp werden. Also vielleicht Kamele? Die sind genügsam, und ihre Milch ist so gesucht, dass der Liter für über 10 Franken verkauft wird. Doch eine Kamelkuh gibt nur zwei bis drei Liter Milch am Tag. Wer mit diesen Tieren Geld verdienen will, muss Kamelreitausflüge anbieten. «Für mich wäre das nicht mehr Landwirtschaft», sagt Thomas Boltshauser.
Vor zwei Jahren verwarf er die Idee, Stall und Viehbestand zu verdoppeln. Zu riskant ist ihm die intensive Milchproduktion geworden. Stattdessen steht jetzt hinter seinem Stall eine neue, turnhallengrosse Pouletproduktionsanlage. Die Solarzellen auf dem Dach liefern den Strom, um die Holzhalle auf Betriebstemperatur zu bringen. Ein Lastwagen bringt 12’000 Küken, nach 32 Tagen werden 3500 Hühner abgeholt, nach 38 Tagen die übrigen. Dann geht es wieder von vorne los. Er produziert Optigal-Poulets für die Migros.
Boltshauser verfüttert ausschliesslich Sojamehl. «Das Huhn ist ein heikles Tier», sagt er. Seine Hühner sind alle schneeweiss, eine Zuchtrasse, entworfen für den strikten Produktionszyklus. Anderes Futter brächte die Abläufe durcheinander. Die Leidenschaft, die er zuvor im Stall bei den Kühen entwickelte, hat ihn vor der Pouletanlage verlassen. Die ist nur ein Geschäft. Pouletfleisch sei gefragt, sagt er, und in zwanzig Jahren habe er die Halle amortisiert – wenn nichts schiefgehe und das Wasser nicht knapp werde. Zweieinhalbtausend Liter trinken die Hühner jeden Tag.
Wasser per Helikopter
Für die Ottoberger Hühner kommt das Wasser aus der Leitung. Für die Tiere von Theophil Caminada kam es diesen Sommer mit dem Helikopter. «Ich bin der Theophil», stellt der Bergbauer sich vor und entschuldigt sich für sein ungewaschenes Auto. Wir fahren hinter Lumbrein im Lugnez, einem Bündner Bergtal, die Alpstrasse hinauf. Es ist neblig, und es regnet, endlich. Auf dem Piz Aul und den umliegenden Graten liegt sogar eine leichte weisse Decke. Darunter erstrecken sich die weiten Matten, und denen sieht man auch nach drei Tagen Regen noch an, wie braun sie diesen Sommer waren.
Caminada stoppt den dunkelblauen Subaru und zeigt auf ein Loch im Geröll neben der Strasse: «Hier kommt eigentlich immer Wasser heraus.» Dieses Jahr nicht mehr. Der sechzigjährige Bergbauer fährt mit der Hand durch seinen Stoppelbart und weiter durch das graubraune Haar. «Mit den Quellen wird es immer schwieriger», sagt er.
Oben auf der Alp zeigt er zwei neue, in den Boden eingelassene Tanks. Jeder fasst 5000 Liter. «Damit kamen wir in den letzten Jahren durch.» Dieses Jahr nicht mehr. Er hat die Daten und Zahlen alle im Kopf. 20. Juli: Das Wasser wird knapp. Absteigen mit den Tieren ins Dorf? Dort zeichnete sich jetzt schon Futtermangel ab. Also oben bleiben. 27. Juli: Es droht Durst. Er und die fünf andern Bauern mit Tieren auf dieser Alp rufen den Helikopter. Er fliegt sechsmal, um die Tanks nachzufüllen. Das reicht – für ein paar Tage: Über den ganzen Sommer werden zwanzig Flüge à 800 Liter nötig, um die Tiere über die Runden zu bringen. Die Kosten für Caminada: 5000 Franken.
Dabei fiel der Schnee im letzten Winter meterdick, und Caminada dachte, 2018 werde ein gutes Jahr. «Wenn einmal ein trockener Sommer auf einen schneearmen Winter folgt, dann geht es nicht mehr», sagt er, und: «Man hofft jetzt halt, dass die nächsten zwei Jahre nicht trocken werden.» Denn die Quellen brauchen Zeit, um sich zu erholen. Und mehr Tanks einzubauen, wäre gefährlich: «Quellen sind launisch. Wenn man gräbt, können sie sich auch ganz zurückziehen.»
Es gibt Pläne, in Zukunft Wasser aus dem Lugnez in den Zervreila-Stausee im benachbarten Valser Tal zu pumpen. Caminada schüttelt den Kopf: «Das Wasser wird schon für uns knapp hier.» Im Winter stehen in seinem Stall fünfzig Tiere. Seine Tochter wird den Hof in ein paar Jahren übernehmen und wegen des Wassermangels vielleicht eines Tages wieder so führen wie Caminadas Vater: «Der übergab mir vor vierzig Jahren eine Maschine, es war ein Motormäher mit Anhänger, und acht Kühe. Und das war damals viel.» Die Zukunft der Landwirtschaft in den hohen Alpen ist wohl extensiv.
Streit ums Grundwasser
Die Wasserfrage treibt fast alle Bauern um. «Zu Recht», sagt Annelie Holzkämper. Sie beschäftigt sich bei Agroscope, der landwirtschaftlichen Forschungsstelle des Bundes, mit den Auswirkungen des Klimawandels: «Die Niederschläge verändern sich, im Sommer gibt es weniger, im Winter mehr.» Und wenn die Gletscher bis auf wenige Reste geschmolzen sind und sechshundert neuen Seen Platz gemacht haben, wird Wasser in den Bergen wohl auch im Sommer noch knapper.
Die Wissenschaftler erwarten regionale Konflikte um das Wasser in Stauseen: Soll es weiterhin nur den Wasserkraftunternehmen zur Verfügung stehen oder auch den Bauern? Oder um das Grundwasser, für die Bauern nach Flüssen und Seen schon heute die zweitwichtigste Wasserquelle. «Da ist das Problem die Qualität. Sie wird schlechter, je tiefer der Spiegel sinkt», sagt Holzkämper.
Doch die Schweiz bleibt das Wasserschloss Europas und hat darum gegenüber Südeuropa oder Ostdeutschland einen Vorteil, der in den nächsten Jahrzehnten noch wichtiger wird. Und viele regionale Wasserkonflikte werden sich hierzulande mit klugem Wassermanagement und dem Anbau der richtigen Sorten entschärfen lassen.
Welche Sorten wären denn das? Agroscope weiss es noch nicht. Die Züchter des Bundes arbeiten zum Beispiel an hitzetoleranteren Weizensorten. Weil es dem Weizen, wie der Kartoffel, jetzt schon zu warm ist. Und weil die Temperaturen in der Schweiz voraussichtlich noch stärker steigen werden als im weltweiten Durchschnitt.
Mit neuen Sorten allein ist es darum nicht getan. Neue Kulturen hätten Potenzial, sagt Annelie Holzkämper. Ernten wir im Seeland in Zukunft Ananas? «Das eher nicht, aber sonst ist vieles möglich.» Melonen zum Beispiel.
Die Exoten
Agroscope denkt auch über Hirse statt Weizen nach, oder darüber, dass in der Schweiz Hochlandrinder weiden und Zitrusfrüchte angebaut werden könnten. Der Leiter des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft in Sissach wiederum riet in der «Basler Zeitung» (Artikel online nicht verfügbar) zu Elsbeerbäumen, weil man sich wegen des Klimawandels das Baselbiet in Zukunft ohne Kirschen vorstellen können müsse.
Auch die Kirsche zählt zu den Klimaverliererinnen. Ausgerechnet die Kirsche. Wo doch zum Fondue ein Kirsch gehört wie zum Geschnetzelten eine Rösti. Eine Süsskartoffelrösti.
Neue Sorten, neue Arten, neue Rassen. Die Bauern sollten mit solchen Überlegungen längst vertraut sein. Ihr Leibblatt, der «Schweizer Bauer», informiert sie regelmässig darüber und über den Klimawandel.
Im April meldete er, dass die Dürregebiete in Europa sich auf «49 Prozent der Fläche ausbreiten könnten».
Im März warnte er vor den Auswirkungen des Hitzestresses und der häufigen Wetterextreme auf die Viehbestände: «Hochleistungsrassen sind besonders gefährdet.» Er riet zu «in Entwicklungsländern gehaltenen Züchtungen».
Im März 2017 warnte Klimaforscher Markus Stoffel im «Schweizer Bauer» vor regelmässigen Hitzesommern, häufigeren Hochwasserkatastrophen und einer Erwärmung in Berggebieten um vier bis sechs Grad. «Schweizer Bauer»: «Müsste ein Supervulkan ausbrechen, um das Klima wieder ins Gleichgewicht zu bringen?» Stoffel: «Das reicht nicht.» Der Vulkan würde zwar so viel Rauch, Staub und Asche in die Atmosphäre pusten, dass die Welt dunkel und kühl würde. Nichts mehr würde reif, und es käme zu einer weltweiten Hungersnot. «Die Auswirkungen wären aber nur zwei, drei Jahre spürbar, das Klima würde sich selbst dann nicht nachhaltig ändern», sagte der Klimaforscher.
Vor zwei Jahren berichtete das Bauernblatt, dass man den Wäldern «in Zukunft wohl auch fremdländische Gastbaumarten beimischen» sollte, zitierte aber auch Pro Natura: «Exoten bilden Fremdkörper im Waldökosystem, weil sie einheimische Arten verdrängen oder Krankheiten oder Schädlinge mitbringen.»
Wie man Wiesen und Weiden dem Klimawandel anpassen kann, war 2016 schon ein Thema: «Besonders empfindlich sind der Weissklee und das Englische Raygras. (...) Angepasste Mischungen enthalten beispielsweise Rohrschwingel, Knaulgras oder Luzerne.»
Kurz: Die Bauern wissen, was auf sie zukommt. Trotzdem arbeiten viele nach dem Prinzip Hoffnung und bleiben bei den alten Sorten und Kulturen.
«Nach diesem Sommer ist noch klarer, dass wir etwas tun müssen», sagt Fabienne Thomas. Sie ist beim Schweizer Bauernverband zuständig für Energie und Umwelt. Nur: Was tun? Von Agroscope bekämen die Bauern noch keine konkreten Antworten. «Weil der Bund ausgerechnet da spart. In der zuständigen Agroscope-Abteilung kam es deshalb sogar zu einem Stellenabbau.» Und statt alles selber züchten zu wollen, könnte Agroscope vielleicht auch mehr über die Landesgrenzen hinausschauen, zum Beispiel nach Südeuropa und auf die Sorten, die sich dort bewährt hätten, sagt Thomas, die fünf Jahre auf einem Bauernhof in Portugal verbracht hat.
Der Bauernverband hat auch eigene Ideen, wie die Schweizer Landwirtschaft auf den Klimawandel reagieren sollte. Sein wichtigstes Anliegen: eine staatlich unterstützte Versicherung für Bauern, die wegen Trockenheit oder anderer Wetterextreme Ernteverluste erleiden. Das klingt eher nach Absicherung als nach Anpassung. «So ist der Trend», sagt Fabienne Thomas. Es sei eben menschlich, zu verteidigen, was man habe und was sich heute verkaufen lasse.
Aber halt, sagt sie, nicht alle Bauern seien passiv. In der Nähe von Biel experimentiere zum Beispiel einer mit Reis.
«Pass auf, dass du keine Schlitzaugen bekommst!»
Hans-Rudolf Mühlheim aus Schwadernau am Nidau-Büren-Kanal sagt, dass er nicht wisse, ob es den Klimawandel gebe. «Aber dass es wärmer wird seit vier, fünf Jahren, das merke ich», sagt der Berner Gemüsebauer, der wohl nicht nur Journalisten mit einer gesunden Dosis Misstrauen begegnet.
Nicht die Sorge um die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft hat ihn dazu bewogen, neben dem Kanal ein Feld zehn Zentimeter tief auszuheben, das halb so gross ist wie ein Fussballplatz, es topfeben zu machen, einige Tausend Setzlinge von Hand hineinzupflanzen, es im ersten Monat täglich zwanzig Stunden und jetzt noch zwei Stunden mit Wasser aus dem Kanal zu fluten und dafür eine Pumpe zu mieten und eine Konzession zu lösen. Er tat es, weil er Reis mag.
Mühlheim steht vor seinem Feld und sagt: «Der erste Versuch vor vier Jahren ging in die Hose.» Da wollte er den Reis trocken anbauen, falsche Methode. Dieses Jahr, im gefluteten Feld, tanzen Halme und schlanke grüne Blätter im Wind – auf den Abschnitten, wo er Setzlinge pflanzte. Wo Mühlheim es mit Direktsaat probierte, spiegeln sich nur die Wolken im Wasser.
Ein Dorfbewohner spaziert vorbei: «Wann gibt es Risotto?»
«Am Freitag ernten wir», sagt Mühlheim.
«Wie gehst du denn rein in diesen Sumpf?»
«Bluttfuss.»
«Pass auf, dass du keine Schlitzaugen bekommst!»
Agroscope unterstützt Mühlheims Experiment, auch finanziell. Doch eine Produktion in grossen Mengen ist nicht in Sicht. Reisanbau würde sich für ihn erst lohnen, wenn er maschinell säen könnte, sagt Mühlheim, und so weit sei er noch lange nicht. «Pro Jahr habe ich nur einen Versuch.»
Wer Neues wagt in der Landwirtschaft, braucht Geduld und muss Rückschläge einstecken können. Darum wohl klammern sich Bauern lieber an die alten Sorten, trotz rückläufiger Erträge. Hans-Rudolf Mühlheim ist anders. Er probiert gern etwas aus. Vor zehn Jahren fing er mit Erdbeeren an. Im ersten Jahr verlor er damit Geld. «Natürlich hat mir keiner gesagt, dass Erdbeeren Blattläuse bekommen, die man nur mit der Lupe sieht.» Er fand heraus, wie man die Pflanzen richtig spritzt, und sonst noch einige Dinge. Nach drei Jahren brachten ihm die Erdbeeren erstmals Einnahmen.
Im Seeland gibt es genug Wasser, die Böden sind gut. Mühlheim baut auf seinen dreissig Hektaren hauptsächlich Zuckerrüben, Sonnenblumen, Weizen, Mais und Karotten an. Aber er experimentiert auch mit Nischenprodukten: Polentamais, Linsen, Buchweizen. «Die sind alle glutenfrei.» Und weil die Jät-Roboter immer besser werden, überlegt er sich, seinen Hof auf Bio umzustellen. «Mein Vater kaufte 1970 die erste Pflanzenschutzspritze. Vielleicht ist jetzt der Moment, damit wieder aufzuhören.»
«Weiter so» ist keine Option
Wenn er aus den synthetischen Pestiziden und mineralischen Düngern ausstiege, dann würde ausgerechnet jener Bauer richtig reagieren auf den Klimawandel, der nicht wissen können wolle, ob es den Klimawandel gebe. So sieht das jedenfalls Markus Steffens: «Wirtschaftlich und ökologisch ist ‹weiter so› in der Landwirtschaft keine Option», sagt der Bodenfachmann vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick.
Markus Steffens beschäftigt sich mit Dreck, oder wissenschaftlicher gesagt: mit Humus. Mit jenem bisschen organischer Substanz also, das Böden fruchtbar macht und garantiert, dass etwas wächst. Die intensive Landwirtschaft der letzten Jahrzehnte entziehe dem Boden schon lange Nährstoffe, sagt Steffens, doch der Klimawandel und die mit ihm verbundene Erosion verschärfe das Problem massiv. Die fruchtbaren Böden verschwänden, «und wenn das nicht aufhört, dann bleiben der Menschheit noch sechzig Ernten, und dann ist Schluss», zitiert Steffens die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO. Dann wächst nur noch ein Bruchteil der Nahrungsmittel von heute.
Wie genau der Humus funktioniert und gemanagt werden kann, weiss man noch nicht. «Ein wirkliches Verständnis für landwirtschaftliche Zusammenhänge gewinnen wir erst in jahrelangen Versuchen.» Das Fricker Institut betreibt solche Versuche, der älteste läuft seit vierzig Jahren. Es zeige sich immer deutlicher, dass biologische Landbaumethoden angebracht seien, sagt Steffens: «Eine kluge Fruchtfolge, wenig pflügen, organischen Dünger klug einsetzen, Biodiversität, Bäume auf Weiden für Tiere – all das ist hilfreich.»
Der Klimawandel? Eine Riesenchance!
Der Thurgauer Biowinzer Roland Lenz sagt über den neusten Jahrgang, was alle Winzer der Welt über jeden neusten Jahrgang sagen: «2018 war ein Traumjahr.» Aber er hat ein Argument: Für Biobetriebe sind trockene Jahre gute Jahre, weil es weniger Pilzbefall gibt.
Dafür gibt es andere Probleme. Lenz musste diesen Sommer seine Ferien abbrechen und die jungen Rebstöcke bewässern, die sonst verdurstet wären. «Bis vor zwei Jahren dachte ich noch, wir bereiten uns auf den Klimawandel vor», sagt er, «doch inzwischen habe ich das Gefühl, der Klimawandel überrollt uns.»
Er arbeitet mit Erdwärme, Fotovoltaik und modernsten Tanks. Jedes Detail seines Betriebs ist so ideal zugeschnitten auf die Produktion wie die Funktionskleidung auf den Körper des hageren, durchtrainierten Bartträgers. Lenz hat eine lange und nicht leichte Geschichte mit Bio. 1995 stellte er seinen Betrieb um; nach schweren Verlusten kehrte er vier Jahre später zum konventionellen Anbau zurück. Sechs Jahre darauf stellte er wieder um. Heute hält er den biologischen Weinbau dem konventionellen für überlegen: «Die auf Spitzenleistung ausgelegten Monokulturen sind viel anfälliger für die neuen Wetterextreme.» Vor allem die Biodiversität, also das Miteinander vieler Pflanzen, Tiere und Rebsorten, mache aus dem Rebberg ein trägeres, aber auch stabileres und gesünderes System.
Doch auch für Biowinzer bleibt der Klimawandel eine Herausforderung. Roland Lenz sucht die richtigen Rebsorten für das zukünftige Schweizer Klima. Pilzresistent müssen sie sein, um in den nassen Sommern zu bestehen, die es weiterhin geben wird. Dicke Häute sollen sie haben, als Schutz gegen Schädlinge, die sich in der wärmer gewordenen Schweiz neuerdings wohlfühlen. Und sie sollen mehr Zeit brauchen bis zur Reife, weil Trauben, die schon im Sommer gelesen werden müssen, weniger Aroma entwickeln und flache Weine ergeben.
Das Burgund etwa stehe vor einem grossen Problem, sagt Roland Lenz. Denn die Trauben der früh reifenden Sorte Pinot noir, die dort dominiert, müssen in Jahren wie diesem viel zu früh gelesen werden. Die französischen Winzer können all ihre Rebstöcke und mit ihnen ihre Tradition nicht einfach so ausreissen. «Für Schweizer Winzer ist der Klimawandel hingegen eine Riesenchance», sagt Lenz. Er hat schon über die Hälfte seiner Rebberge mit neuen Sorten bestockt. Wenn er recht hat, wachsen in der Schweiz die Topweine von morgen.
Ob man die noch geniessen können wird, wenn sich in Südeuropa die Wüste ausbreitet, die Erträge der Landwirtschaft weltweit sinken und einige Millionen Menschen vor Hitze, Hunger und Dürre fliehen – das ist der Stoff für andere Geschichten.