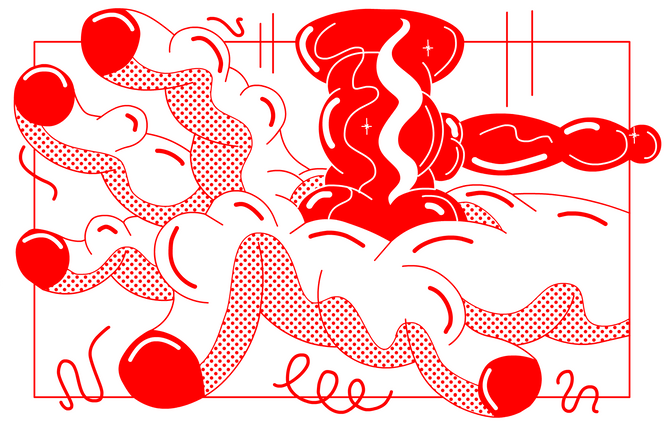
Eine Verkehrskontrolle gerät ausser Kontrolle
Eine Staatsanwältin verklagt ein älteres Ehepaar wegen Gewalt und Drohung gegen die Polizei. Der Einzelrichter sagt: komische Anklage. Der Strafverteidiger: zitiert Kafka. Der Bundesrat: alles Zeichen der Zeit. Ein Fall zum Verhältnis zwischen Bürger und Staat.
Von Yvonne Kunz, 04.07.2018
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Ort: Einzelrichteramt Zürich
Zeit: 27. Juni 2018, 8.30 Uhr
Fall-Nr.: 2017/10021432
Thema: Gewalt und Drohung gegen Beamte und Behörden, Hinderung einer Amtshandlung, Förderung des illegalen Aufenthalts
Am 30. Juni 2017, nachts um eins: Eine Streife der Kantonspolizei Zürich führt in Watt bei Regensdorf eine Verkehrskontrolle durch. Eine Frau kann sich nicht ausweisen. Sie sagt, sie sei brasilianische Staatsangehörige, ihr Pass sei in der Wohnung einer Freundin. Ihr Name taucht in keinem Personensuchsystem auf, die Polizei vermutet illegalen Aufenthalt. Die Beamten nehmen die Frau zwecks Identifizierung mit.
Kurz nach zwei wird in der Stadt Zürich ein pensionierter Psychiater aus dem Schlaf geklingelt. Er ist verärgert. Hatte er seinem Übernachtungsgast nicht gesagt, der Schlüssel liege im Briefkasten? Warum läutet der jetzt Sturm? Schlaftrunken schlurft er zur Tür und drückt ohne Nachfrage auf den Öffner.
Doch nicht sein Bekannter erscheint in der Tür, sondern die verdatterte Freundin seiner brasilianischen Ehefrau – flankiert von zwei uniformierten Polizisten. Sie bleibt stumm, die Beamten erklären, man benötige den Ausweis der mitgeführten Person, ob man hereinkommen dürfe. Der Psychiater hat die Frau schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Sie hatte die Wohnung gehütet, während das Ehepaar längere Zeit in Brasilien weilte. Möglich, dass noch ein paar ihrer Sachen da sind. In der Wohnung herrscht aber nicht die beste Ordnung, es ist mitten in der Nacht, er steht nur mit einem T-Shirt bekleidet unten ohne im Treppenhaus. Und überhaupt: Durchsuchungsbefehl?
Inzwischen ist auch seine Frau da und redet portugiesisch auf ihre Freundin ein, fasst dabei an ihren Unterarm. Einer der Polizisten zieht Handschellen hervor, ohne Pass müsse man die Freundin abführen. Das scheint dem Psychiater übertrieben, man sehe doch sofort: Das ist eine harmlose, ältere Frau, religiös übrigens, aus einfachsten Verhältnissen. Und schon hat er eine Ladung Pfefferspray im Gesicht. Keine drei Minuten nachdem die Türglocke läutete.
Kurz nach drei sitzt der Psychiater leicht ramponiert in einem Verhörraum auf der Polizeiwache am Zürcher Hauptbahnhof. Ein Polizist brüllt ihn an. Die Schweiz ist doch kein Unrechtsstaat, sagt sich der 73-Jährige immer wieder. Gleich wird sich alles klären. Als er 36 Stunden später aus einer Zelle tritt, ist nichts mehr klar.
Ein Chaos sondergleichen
Ein Jahr später, letzten Mittwoch, steht er wegen mehrfacher Drohung und Gewalt gegen Beamte und Behörden sowie Hinderung einer Amtshandlung vor Gericht. In der Befragung durch Einzelrichter Roger Harris schildert der Psychiater, wie hartnäckig seine Gedanken bis heute kreisen: um Gerechtigkeit, das Schweizer Rechtssystem, jede Nacht. Er nimmt jetzt Schlaftabletten. Neben ihm seine Frau, per Strafbefehl abgeurteilt wegen derselben Delikte sowie Förderung des illegalen Aufenthalts. Dagegen hatte sie Einsprache erhoben und will heute mit ihrem Mann freigesprochen werden. Es ist unklar, weshalb die Fälle nicht von Anfang an zusammen behandelt wurden.
«Komische Anklage», entfährt es auch dem Richter beim Versuch, sich den eingeklagten Sachverhalt vorzustellen: Wann genau die Beschuldigten Gewalt angedroht oder angewendet haben sollen, zur Verhinderung welcher Amtshandlungen. Staatsanwältin Catherine Gigandet-Reiser kann er nicht fragen – weil sie keine unbedingte Strafe verlangt, musste sie nicht erscheinen.
In der Anklageschrift schreibt sie, der Beschuldigte habe die Fäuste geballt und sei mit ausgestreckten Armen auf die Polizei zugerannt. Nach dem Pfefferspray-Einsatz habe die Polizei befürchtet, er hole eine Waffe. Auch das überzeugt Richter Harris nicht – Pfefferspray wirke ja nicht erst nach ein paar Minuten, wie die Anklägerin zu glauben scheint.
Die Polizei habe sie angewiesen, die Fenster zu öffnen, sagt dann die Ehefrau im Gerichtssaal. Der eine Polizist brachte ihre Freundin in den Einsatzwagen, der andere kümmerte sich im Badezimmer um ihren Mann. Die Situation beruhigte sich, und sie unternahm einen Versuch, die Sache mit dem Pass zu klären. Falls er nicht auftauche, würde sie mit der Frau am nächsten Tag zum Konsulat gehen. «Aber der Polizist konnte mich nicht verstehen und ich ihn nicht», sagt sie. Und plötzlich sei eine Unmenge Polizei da gewesen. Im Polizeirapport steht: Die Situation eskalierte, Verstärkung wurde angefordert.
Gemäss Anklage gegen den Psychiater weigerte sich die Ehefrau, den vier zusätzlich angerückten Polizisten einen Ausweis zu zeigen. Im Strafbefehl gegen die Frau aber fehlt der Vorwurf. «Wir haben hier ein Chaos sondergleichen», seufzt Richter Harris. Stimmt schon, sagt die Frau, sie habe sich aufgeregt. «Emotional» sei sie geworden, schreibt die Staatsanwältin in der Anklage, immerfort habe sie geredet und «mit den Händeln gefuchtelt». Zwei Mal habe sie dabei einen Beamten «am Brustkorb getroffen». Oder «berührt», wie es anderswo heisst. Oder «leicht geklopft», wie der Polizist sagt. «Achtung, sie beisst!», brüllte dann ein anderer.
Zu dem Zeitpunkt sass der Psychiater am Küchentisch. Noch immer belämmert, aber immerhin bekleidet. Er hörte seine Frau schreien und sah, wie sie zu Boden gebracht und an Händen und Füssen gefesselt wurde. Er habe zu ihr gewollt, um sie zu beruhigen – und schon klickten auch bei ihm die Handschellen. Dabei, sagt die Polizei, habe er dem Beamten in den Intimbereich geschlagen. Der Schlag habe beim Beamten «an besagter Stelle leichte Schmerzen ausgelöst», weshalb auch der Ehemann zu Boden gebracht werden musste. Richter Harris blättert in den Akten. «Nein», sagt er dann, «keine Schmerzen.» Hat der betreffende Polizist in der Einvernahme bei der Staatsanwältin so bestätigt.
Ein Fall – sechzehn Anzeigen
Es ist kein Einzelfall: Bürger und Beamte kriegen sich ständig in die Haare. Überall wird geunkt, der Anstand vor Amtsträgern, der Respekt vor Autoritäten sei dahin. Sanitäter werden angepöbelt, wenn sie helfen, und Feuerwehren angegriffen, wenn sie löschen. Das zeigen auch die Zahlen der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik: 3102 gemeldete Fälle im letzten Jahr, eine Zunahme von über 12 Prozent gegenüber 2016. Auch in Bundesbern ist die Gewaltbereitschaft der Zivilbevölkerung gegenüber staatlichen Institutionen Dauerthema: Seit 2008 bemühten sich alarmierte Parlamentarierinnen und entnervte Polizeikorps mit insgesamt elf Postulaten, Standesinitiativen und Motionen um Gesetzesverschärfungen. Wer einen Polizisten angreift, so der Tenor, gehört in den Knast.
In seinem Bericht vom 1. Dezember 2017 zum «besseren Schutz der Staatsangestellten» winkte der Bundesrat zum wiederholten Mal ab. Das Problem sei erkannt – aber man müsse den mangelnden Respekt gegenüber dem Staat im Kontext allgemeiner Entwicklungen sehen: im Zeitgeist des digitalen Wutbürgertums, im Sinne einer dauerbedröhnten 24-Stunden-Gesellschaft. Und die Zahlen enthielten ein Paradox: Einerseits muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, aber auch von einem veränderten, erhöhten Meldeverhalten bei der Polizei.
In diese Kerbe schlägt auch Strafverteidiger Bernard Rambert. 16 Anzeigen produzierte allein dieser Fall: «Zwei Delikte mal vier Polizisten gegen zwei Beschuldigte.» Dabei wären die Anforderungen schon für eine Drohung hoch. Das Gesetz geht davon aus, dass Polizeibeamte besonders geschult sind im Umgang mit renitenten Personen. Und hier soll ein halbwacher, halbnackter älterer Papeli zwei 30-jährige Muskelprotze in Angst und Schrecken versetzt haben?
Vertuschung eines Übergriffs
Gewalt müsse sowieso eine gewisse Intensität aufweisen, um als solche zu gelten, sagt Rambert. Konstitution und Geschlecht der Opfer – hier vier junge, kräftige Kantonspolizisten – müssten berücksichtigt werden. Hier gab es keine Verletzungen, ausser einem – mit Bildern dokumentierten! – Kratzer. Sollte den Polizisten damit ernst sein, dann seien sie im falschen Beruf, sagt Rambert. Aber er glaubt, die Beamten wollten mit ihren Anzeigen nicht nur einen brutalen, kafkaesken polizeilichen Übergriff vertuschen, sondern auch einen teuren Leerlauf rechtfertigen. Deshalb hätten sie diese Story erfunden, schlecht noch dazu. «Frauen beissen, Männer holen Waffen, wie stereotyp.»
Bei diesem Prozessverlauf überraschen die vollumfänglichen Freisprüche nicht. Gewalt, sagt der Richter, stehe ohnehin ausser Diskussion, das gehe ja aus den Aussagen der Polizisten selbst hervor. Verhinderte Amtshandlungen? Fehlanzeige. Die Freundin der Frau habe sich ja schon in Polizeigewahrsam befunden und sei kooperativ gewesen. Das habe die Polizei ja selbst gesagt. Das Gesetz sei klar: Die Polizei darf im Interesse der Sicherheit jemanden zur Klärung der Identität mitnehmen – auf den Polizeiposten. Aber deswegen mitten in der Nacht eine Hausdurchsuchung durchzuführen, verstosse gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip. Wenn es denn überhaupt diese Amtshandlung gewesen sei, die behindert worden sei, aber das stehe ja eben nirgends. Ein Verstoss gegen das Anklageprinzip.
Bei der angeklagten Ehefrau spielte all das aber ohnehin keine Rolle. Ihr Freispruch sei nur schon deshalb zwingend, weil die Staatsanwältin sie per Strafbefehl aburteilte, ohne sie angehört zu haben. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Oder wie Richter Harris sagt: «Da kann man gleich aufhören.» Er spricht dem Ehepaar insgesamt 2800 Franken Genugtuung zu.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin wird sich den Weiterzug an die nächste Instanz aber gut überlegen: Sollte es in Rechtskraft erwachsen, wird das sistierte Verfahren gegen die Polizisten wegen Amtsmissbrauch wieder aufgenommen.
Illustration Friederike Hantel