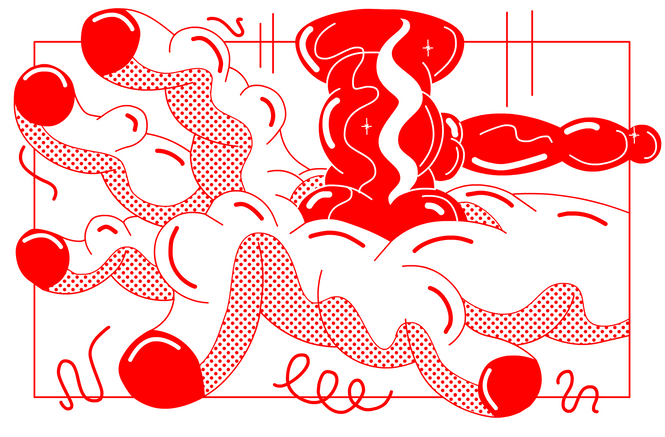
Die Hand an der Krawatte des Kondukteurs
Ein leicht handgreiflich ausgetragener Streit in einem Zug der SBB führt zu einem Prozess vor Bundesstrafgericht. Dieser mündet – nach nicht ganz alltäglichem Verlauf – in ein Urteil mit gleich zwei Fragezeichen.
Von Markus Felber, 13.06.2018
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Ort: Bundesstrafgericht Bellinzona
Zeit: 30. Mai 2018
Urteilsreferenz: SK.2018.19
Thema: Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Beschimpfung
Die Verhandlung findet im kleinen Saal des erst vor knapp fünf Jahren fertiggestellten Gerichtsgebäudes am Viale Stefano Franscini in Bellinzona statt. Der Raum ist quadratisch, luftig und hell. Die Richterbank steht auf gleicher Höhe wie alle anderen Sitze, was eine angenehm entspannte Atmosphäre schafft. Die Beschuldigte, eine elegante Dame mit Jupe und hochhackigen Schuhen, wirkt nervös und hilflos. Man will ihr nicht zutrauen, was ihr die Bundesanwaltschaft unter anderem vorwirft: Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Konkret geht es um eine eher banale Auseinandersetzung im Rahmen einer Billettkontrolle im Zug zwischen St. Gallen und Zürich kurz vor sechs Uhr morgens am 14. Oktober 2017.
In aller Regel macht das Bundesstrafgericht durch spektakuläre Fälle von sich reden, die im grossen Saal gleich nebenan verhandelt werden. Dabei geht es um Wirtschaftskriminalität oder Öko-Terrorismus sowie zunehmend um Prozesse im Umfeld des Islamismus. Dass in Bellinzona auch simple Vorfälle aus dem Alltag zur Beurteilung gelangen, wird selten wahrgenommen. Dazu kommt es aber regelmässig, wenn eine Straftat in die Zuständigkeit der Bundesjustiz fällt und die beschuldigte Person den Strafbefehl der Bundesanwaltschaft nicht akzeptiert.
So geschehen in dem zu Bellinzona verhandelten Fall: Die aus der Slowakei stammende Beschuldigte hatte sich mit einem Kondukteur der Bundesbahnen überworfen, und damit war die Bundesanwaltschaft zuständig. Sie verurteilte die Frau per Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen Beschimpfung zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse, die auf jeden Fall bezahlt werden muss. Zusätzlich sollte sie die Verfahrenskosten von 300 Franken berappen. Das wollte die Beschuldigte nicht hinnehmen und erhob Einsprache, worauf die Bundesanwaltschaft den Strafbefehl ans Bundesstrafgericht überwies. Samt «Bundesordner (klein) mit Verfahrensakten», einem «USB-Stick verschlüsselt mit Verfahrensakten» sowie dem dazugehörigen Passwort «mit separatem Fax-Schreiben».
Beim Prozess in Bellinzona glänzt die Bundesanwaltschaft durch Abwesenheit, vermutlich wohl wissend, wie der Hase laufen würde. Denn die Beschuldigte erscheint ohne Anwalt oder anderen Beistand. Einzig der als Privatkläger auftretende Kondukteur sitzt – ebenfalls unbegleitet – im Saal, und es zeichnet sich ab, dass das Verfahren zu einer Art Dorfgerichtsprozess werden könnte, in dem der Richter auch Funktionen von Verteidiger und Ankläger übernehmen muss. Kurz nach zehn Uhr lässt der Gerichtsweibel die Beschuldigte, den Privatkläger sowie den Journalisten aufstehen. Einzelrichter Emanuel Hochstrasser betritt mit seiner Schreiberin den Saal und versucht in den folgenden zwei Stunden zu klären, was sich im vergangenen Oktober im Oberdeck des Zugs von St. Gallen nach Zürich abgespielt hat.
Unbestritten ist, dass die Beschuldigte am Vortag online ein Ticket nach Zürich gekauft hatte. Das speicherte sie auf Ihrem iPad, das sie aber am Morgen zu Hause vergass. Der Kontrolleur verlangte deswegen dreissig Franken, die sie partout nicht zahlen wollte. Was danach ablief, ist umstritten. Laut Strafbefehl, der vor Gericht zur Anklageschrift wird, riss die Frau den Kontrolleur «mehrfach an der Krawatte, packte ihn am Arm und am Hemd, verpasste ihm eine Ohrfeige, versuchte ihn anzuspucken und betitelte ihn als Arschloch sowie als Asozialen».
Bei der Befragung konzentriert sich das Gericht auf Krawatte, Spuckversuch und Arschloch. Der Rest bleibt weitgehend aussen vor. Der Privatkläger bestätigt die Vorwürfe erwartungsgemäss, und die Beschuldigte ist ohne Anwalt ausserstande, seine Glaubwürdigkeit auch nur anzuritzen. Sie stellt alles in Abrede und verstrickt sich in Widersprüche. Was vorwiegend auf die Aufregung sowie auf Schwierigkeiten mit der ihr fremden deutschen Sprache zurückzuführen sein dürfte. Sie antwortet meist, bevor der Richter seine Frage zu Ende formulieren kann. Angespuckt habe sie den Kondukteur sicher nicht, das dürften in der slowakischen Kultur nur Männer, Frauen nicht. Ihr Wortschwall wird einzig um 11.56 Uhr kurz unterbrochen, als auf der Richterbank ein Handy klingelt. Erst mit der Zeit wird verständlich, was sie dem Gericht sagen will: Sie fühlte sich ihrerseits bedrängt durch das forsche Auftreten des Kontrolleurs und will den Vorfall nach der Ankunft in Zürich denn auch der Polizei gemeldet haben.
Schliesslich wird eine Zeugin in den Saal geführt, die das Geschehen im Zug als Mitfahrerin beobachtet hat. Sie fragt als Erstes, ob sie Schweizerdeutsch sprechen dürfe. Hochdeutsch wäre besser, meint Einzelrichter Hochstrasser. Doch bei der weiteren Befragung verfällt er selber in Mundart. Was nicht ganz unproblematisch ist, denn Schweizerdeutsch kann laut dem Gesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes nicht Verfahrenssprache sein. Zudem belastet die Zeugin die Beschuldigte, und die kann nur ungenügend Deutsch. Denn in der Sache bestätigt die resolute ältere Dame nicht nur den Griff an die Krawatte des Kontrolleurs. Dass er angespuckt wurde, will sie ebenfalls gesehen haben. Nicht gehört hat sie dagegen den Kraftausdruck Arschloch, was sie auf die zu grosse Distanz zum Geschehen zurückführt.
Das Recht, die Zeugin zu befragen und ihre Glaubwürdigkeit zu hinterfragen, wird auch hier zur Farce: Ohne Rechtsbeistand ist die Beschuldigte dazu nicht in der Lage und beschränkt sich auf die wiederholte Frage: «Warum lügen Sie?» Schliesslich wird die Zeugin entlassen, was sie mit «Super!» quittiert. Das Angebot eines Zeugengelds von 150 Franken nimmt sie herzhaft an und marschiert mit der Mineralwasserflasche in der Hand stolz aus dem Saal.
Nach ihrem Abgang fordert der Einzelrichter die Parteien auf, ihre Anträge zu stellen, und überfordert damit offensichtlich alle beide. Doch Hochstrasser macht als Dorfrichter eine erstaunlich gute Figur und kaut die Anträge vor: Der Privatkläger will eine angemessene Bestrafung und die Beschuldigte einen Freispruch. Beide bestätigen nickend. Ob sie für den Fall eines Freispruchs eine Entschädigung beanspruche, fragt Hochstrasser die Frau. Doch ihr geht es nur um den Freispruch, und der Preis dafür scheint ihr egal zu sein. Darum verfängt auch das richterliche Angebot nicht, sie könne ihre Einsprache jetzt noch zurückziehen und sich damit eine Menge an Kosten sparen. Die Frau bleibt dabei, sie will einen Freispruch und nichts anderes. Die Urteilsverkündigung setzt der Einzelrichter auf 15 Uhr an.
Pünktlich um 15 Uhr warten die Beschuldigte und der Journalist auf den Urteilsspruch. Der klagende Kondukteur ist nicht aus der Mittagspause zurückgekehrt. Da sich die Ankunft des Gerichts verzögert, bleiben wir sitzen. Mit ein paar Minuten Verspätung schreitet Hochstrasser in den Saal und meint leicht indigniert: «Sie können sich setzen, auch wenn Sie gar nicht aufgestanden sind!»
Dann gibt er bekannt, dass das Bundesstrafgericht den Strafbefehl im Schuldspruch bestätigt. Die Beschuldigte versteht erst allmählich das für sie offensichtlich unfassbare Verdikt und will den Saal verlassen. Doch der Dorfrichter hält sie zurück: «Sie müssen zuhören!» Und so erfährt sie, dass das Gericht die von keinem Verteidiger kritisch hinterfragten Aussagen des Privatklägers und der Zeugin für glaubwürdig erachtet. Allerdings wertet es ihr Verschulden viel geringer als die Bundesanwaltschaft und reduziert die bedingte Geldstrafe massiv von 90 auf 40 Tagessätze. In harter Währung gerechnet von 3600 auf 1600 Franken. Die Busse von 600 Franken wird sogar ganz gestrichen.
Was die Kosten anbelangt, sieht die Bilanz weniger rosig aus. Statt der 300 Franken für den Strafbefehl will die Gerichtskasse nun 2434 Franken von der Verurteilten. Darauf gibt es 500 Franken Rabatt, wenn sie auf eine schriftliche Urteilsbegründung und damit auf eine Beschwerde ans Bundesgericht verzichtet. Einen Weiterzug nach Lausanne kann sich die Verurteilte vermutlich nicht leisten. Und so wird wohl nicht höchstrichterlich geklärt, ob hierzulande der blosse Griff nach der Krawatte eines Kondukteurs bereits als Gewalt gegen Beamte strafbar ist.
Die zweite und brisantere Frage stellt sich mit Blick auf das Strafbefehlsverfahren: Das Gericht hat die von der Bundesanwaltschaft verhängte Geldstrafe um mehr als die Hälfte reduziert und die Busse ganz gestrichen. Doch dieser beachtliche Teilerfolg kostet die Beschuldigte gut sechsmal mehr an Gebühren und Auslagen als der Strafbefehl. Wer rechnet, akzeptiert daher besser einen Strafbefehl. Auch wenn er so mit grosser Wahrscheinlichkeit zu hart bestraft wird. Denn auch Staatsanwälte können rechnen und brauchen sich deshalb beim Strafmass nicht zurückzuhalten. Das ist rechtsstaatlich umso bedenklicher, als mittlerweile rund neun von zehn Strafprozessen nie vor Gericht gelangen, sondern bereits mit dem Strafbefehl enden.
Illustration Friederike Hantel