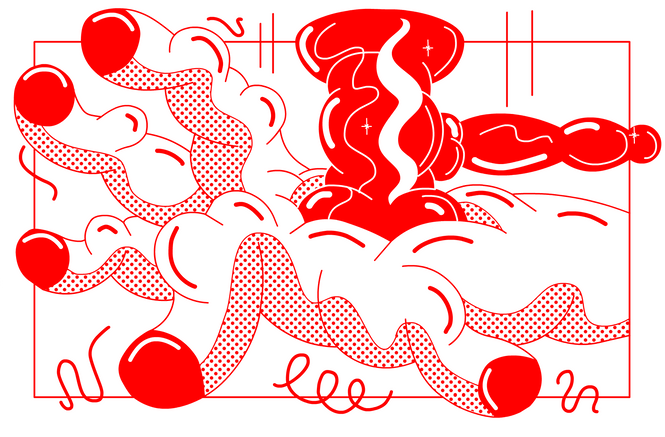
Der Zuhälter, der keiner sein will
Vor fast fünf Jahren wurde der Strassenstrich am Zürcher Sihlquai geschlossen. Doch die juristischen Aufräumarbeiten dauern an: Ein Berufungsverfahren um einen ungarischen Zuhälter als abgründige Groteske.
Von Yvonne Kunz, 23.05.2018
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Ort: Obergericht Zürich
Zeit: 17. Mai 2018, 10.00 Uhr
Fall-Nr.: DG160321
Thema: Menschenhandel, Förderung der Prostitution, strafbarer Schwangerschaftsabbruch, versuchte schwere Körperverletzung
Aus den Augen, aus dem Sinn, aus den Schlagzeilen – vergessen sind die Zeiten, als den Passanten am Zürcher Sihlquai Mitte der Nullerjahre die blanken Backen und das nackte Elend osteuropäischer Prostituierter entgegenblitzten. Ein paar Jahre später offenbarten medienträchtige Prozesse gegen «Roma-Zuhälter» mit so glamourösen Rufnamen wie «Samurai» oder «Goldfinger» eine unvorstellbare Verrohung des Sexgewerbes. Dutzende Frauen waren auf widerwärtigste Weise ausgebeutet und misshandelt worden. Zum Beispiel: nicht nur vergewaltigt, sondern vergewaltigt mit einem Chili in der Scheide.
Auch in diesem Fall an einem Donnerstag Mitte Mai sind die Schilderungen der zwei Hauptzeuginnen drastisch. Und doch gehörte der Beschuldigte nicht zu den schlimmsten Sadisten der Szene. Zu diesem Schluss gelangte letztes Jahr das Bezirksgericht Zürich, das ihn wegen «mehrfacher Förderung der Prostitution» schuldig sprach, nicht aber wegen Menschenhandels. Auch vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung wurde der Ungar freigesprochen. Das heisst wenig: «Unerlaubter Schwangerschaftsabbruch», lautete der zweite Schuldpunkt. Als die jüngere der zwei Zeuginnen schwanger wurde, wahrscheinlich vom Beschuldigten selbst, stand er ihr mit seinen ganzen 95 Kilogramm auf den Bauch. Sie verlor ihr Ungeborenes.
«In gegenseitigem Respekt»
Der heute 46-Jährige machte seine kaum gebildeten Landsfrauen aus bitterarmen Verhältnissen vor allem mittels Zuneigung und Hoffnung gefügig. Der einen versprach er ein ungarisches Spezialitäten-Restaurant, die andere sollte ihr eigenes Nagelstudio bekommen. Mindestens für eine solide Grundlage hätten ihre Verdienste gereicht: Von 2009 bis 2011 müssen nach Berechnungen der zuständigen Staatsanwältin Sabine Tobler auf den Strassenstrichen von Zürich, Olten, Chur und Luzern um die 450’000 Franken zusammengekommen sein – pro Frau. Doch der gesamte Erlös floss in die Tasche des Beschuldigten, versiegte in dessen glücklosen Versuchen, sein Geschäft mit Erotikstudios und Kontaktbars zu erweitern.
«Alles niederträchtige Lügen», sagt der Beschuldigte während der Befragung durch den Gerichtsvorsitzenden Rolf Naef. Rein gar nichts habe er den Frauen versprochen. Repressionen, wenn sie ihre Einnahmen nicht abgeben wollten? Gabs nicht. Nicht einmal Ohrfeigen oder auch nur einen verbalen Streit. Glaubt man seinen Ausführungen, ist der Mann ein edler Ritter weiblicher Selbstbestimmung: Alle Geschäfte seien «in gegenseitigem Respekt» abgewickelt worden. Hätte eine Frau rausgewollt, er hätte ihr glatt die Heimfahrt bezahlt. Mal für einen anderen Zuhälter arbeiten? Kein Problem.
Er habe die Frauen auch nicht gezwungen, sieben Nächte die Woche zu arbeiten, oder sie angewiesen, ihre Freier ohne Gummi zu bedienen, wenn sie schwanger waren. Im Gegenteil: Sie kriegten sozusagen bezahlten Schwangerschaftsurlaub. Auch von einer strikten Kontrolle der Frauen will der Beschuldigte nichts wissen: War zu ihrem Schutz, den sie dringend nötig hatten, die Polizei stand ja ständig im Stau. Chauffiert habe er die Mädchen, für sie gedolmetscht, ihnen Essen gebracht. Eigentlich hätten nicht die Frauen für ihn gearbeitet, sondern er für die Frauen. Für durchschnittlich 5000 Franken im Monat. Aber ums Geld sei es ihm eh nicht gegangen, sondern um das Wohl der Mädchen.
Die Verschwörung
Gegen Ende der über dreieinhalbstündigen Befragung massiert sich der Gerichtspräsident sanft die Stirn. Nach seiner letzten Frage, warum ihn denn die zwei Frauen dermassen belasteten, lässt er den Beschuldigten einfach reden. Der monologisiert nun seit mehreren Minuten eine wirre Seifenoper in den Saal, und man steckt seit dem dritten Satz im Dickicht der Details fest: Probleme mit Aufenthaltsbewilligungen, Zoff wegen Kindern, die dann doch nicht vom einen, sondern vom andern waren, betrogene Männer und eifersüchtige Frauen, Rache – all das habe sich irgendwie zu einem Komplott verdichtet, angestiftet von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ). Richter Naefs Kopf ruht jetzt zwischen seinen Händen.
Staatsanwältin Tobler will im Berufungsverfahren doch noch einen Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung erwirken und die Strafe von drei Jahren und acht Monaten auf fünf Jahre erhöhen lassen. Es sei zynisch, merkt sie an, dass die Vorinstanz diesen Straftatbestand mit der Begründung verneint habe, der Beschuldigte habe kein Interesse an einer Verletzung der Geschädigten gehabt, da sie ja für ihn eine Einnahmequelle darstellte. Noch mal: Der Beschuldigte sei mit dem Gewicht einer handelsüblichen Waschmaschine auf den Bauch einer auf dem Rücken liegenden Frau getreten. Man brauche nicht Rechtsmedizin studiert zu haben, um zu ahnen, dass das schwerwiegende Folgen haben kann – nicht nur für das Ungeborene, sondern auch für die Frau.
Strafverteidiger Sararard Arquint fordert hingegen einen vollumfänglichen Freispruch, die sofortige Freilassung des Beschuldigten und 200 Franken Entschädigung für jeden der inzwischen bald 1000 Tage Haft. Die Staatsanwaltschaft operiere schon während des gesamten Verfahrens mit mächtigen Bildern, um Emotionen gegen den Beschuldigten zu schüren: «Das ungeborene Kind», zum Beispiel: «Das war ein zwei Millimeter grosser Embryo», sagt Arquint. Und der sei nicht getötet worden, ein Tritt in den Bauch erreiche die Gebärmutter gar nicht. Dann «die Menstruation»: Da werde suggeriert, es sei «megaschlimm» für die Prostituierten, während ihrer Tage zu arbeiten. «Dem muss nicht so sein», sagt der Anwalt.
Der Fall habe mehr Facetten als den brutalen Zuhälter und die wehrlosen, geknechteten Prostituierten, sagt Arquint weiter. Beeinflusst von früheren Exzessen am Sihlquai, hätten die Behörden die Perspektive des Beschuldigten gar nie ernst genommen und derweil Dreistigkeit und Verschlagenheit der Dirnen von vornherein ausgeschlossen. Dabei hätten die Frauen konfuse bis völlig widersprüchliche Aussagen gemacht. Ihr Eigeninteresse sei doch augenfällig: Sie waren auf die Entschädigung durch die Opferhilfe aus. Und seitens der FIZ seien die Frauen von derselben Person betreut worden: Ein «Informationstransfer» liege da auf der Hand.
So etwas wie ein Happy End
Ja was denn jetzt, mokiert sich die erste Geschädigtenvertreterin. Sind die Aussagen nun widersprüchlich? Oder haben sich die Frauen abgesprochen? Da müsse sich der Herr Verteidiger schon entscheiden. Und dann noch dies: Es sei etwas speziell, wenn ein männlicher Kollege Kommentare zur Menstruation abgebe. Klar: Ist nicht bei jeder gleich. Aber gerade im Sexgewerbe müsse es der Frau überlassen sein, ob sie während ihrer Tage arbeite. Stattdessen habe der Beschuldigte die Frauen gedrängt, sich einen Schwamm in die Vagina zu stopfen. Einen solchen musste sich die eine Frau gar mal im Spital entfernen lassen.
Die zweite Opferanwältin betont noch einmal, wie geschickt der Beschuldigte mit den Träumen der Frauen gespielt habe, um sich selbst ein bequemes Leben zu leisten. Doch sie schliesst mit einem Happy End: Vor fast zehn Jahren sei ihre Mandantin grün und blau geschlagen in Zürich angekommen. Geflohen vor noch grösserem Elend, stand sie am Sihlquai. Inzwischen kann sie Deutsch und hat ihren Platz im Leben gefunden. Demnächst beginnt sie ein Praktikum in der Altenpflege, danach, wenn es gut läuft, eine Lehre.
Das Obergericht folgt den Anträgen der Staatsanwältin voll und ganz. Ein kleines Stück Vergangenheit ist damit juristisch bewältigt – eine Vergangenheit, die aber auch Gegenwart und Zukunft ist, hier und anderswo. Seit der Aufhebung des Strassenstrichs am Sihlquai, das halten die Strafverfolgungsbehörden fest, haben bestimmte ungarische Tätergruppierungen ihre Aktivitäten in andere Kantone oder ins umliegende Ausland verlagert. Prostituiertenberatungsstellen sagen, das Sexgewerbe sei lediglich weniger sichtbar geworden. Die FIZ meldet im soeben erschienenen Jahresbericht beim Frauenhandel stabile Zahlen. Noch immer stehen unter den Sexarbeiterinnen die Ungarinnen an der Spitze – dies seit 2008.
Illustration Friedrike Hantel