
Gewinner und Verlierer
Der Libanon hat gewählt. Die Hizbollah legt zu, auch mithilfe christlicher Alliierter. Und Saad Hariri dürfte wieder Premierminister werden. Was das bedeutet? Reportage aus einem Land, das auf den Toten und Trümmern seiner Geschichte durch die Kriegswirren der Gegenwart taumelt. Teil III.
Von Mona Fahmy (Text) und Dalia Khamissy (Bilder), 07.05.2018
Die ersten Parlamentswahlen seit 2009 verliefen erstaunlich ruhig im Libanon. Abgesehen von ein paar Anschuldigungen wegen Wahlbetrugs und einem Toten bei Freudenschüssen sind bis jetzt keine grösseren Vorfälle bekannt. Ausschreitungen? Kämpfe? Ein Attentat? Nichts dergleichen ist geschehen. Noch nicht.
Der Libanon bleibt ein Land am Rande des Abgrunds. Wie er das seit Jahrzehnten ist. Ein Land der krassen Gegensätze. Bettler und Milliardäre, Krieg und Party. Trotz des Bürgerkriegs, Millionen von Flüchtlingen und Hunderttausenden Toten schaffen es die Libanesen, ihren Alltag zu meistern. Irgendwie.
In den beiden ersten Teilen der Libanon-Serie trafen wir die Palästinenserin Amal im Camp Shatila in Beirut, Schauplatz des Massakers von 1982. Reisten in den Süden des Landes, wo die Hizbollah den Märtyrerkult um die «Helden des Widerstands» zelebriert. Wir trafen Warlords und geläuterte Kämpfer zum Kaffee. Christen, Drusen. Kommunisten. Sie erzählten, wie es war, zu foltern, zu töten. Geschichten, die zeigen, wie fragil die Ruhe im Land ist. In einer Weltgegend, in die sich viele Mächte einmischen und jeder Funke die nächste Explosion auslösen kann.
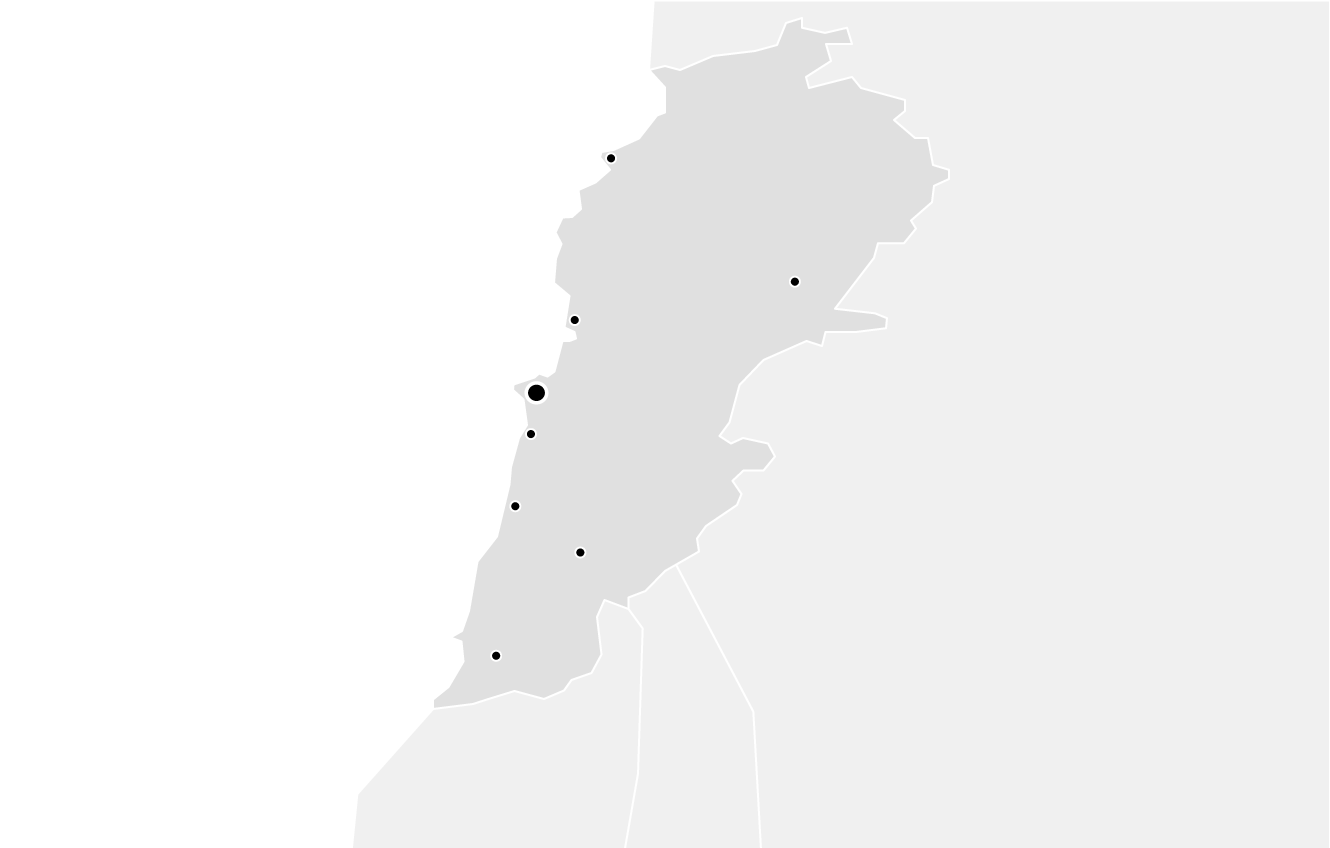
Tripoli
Libanon
Bekaa-Tal
Mittelmeer
Safra
Beirut
Damur
Syrien
Said
Mleeta
Qana
Israel
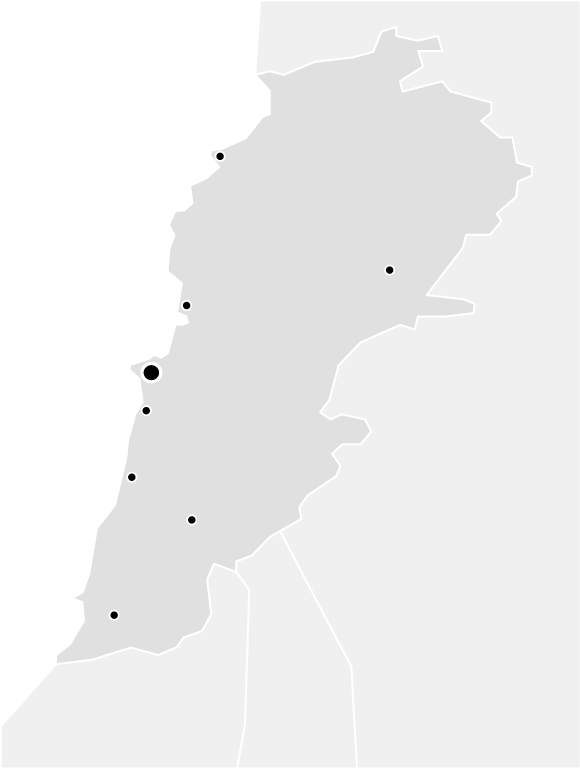
Mittelmeer
Tripoli
Libanon
Bekaa-Tal
Safra
Beirut
Damur
Said
Syrien
Mleeta
Qana
Israel
Im dritten Teil treffen wir Michel Moawad, der seinem ermordeten Vater in die Politik und damit vielleicht in den Tod folgt. Reisen zu Flüchtlingen aus Syrien im Bekaa-Tal. Unweit der Kampfzone zwischen der Terrororganisation Daesh – im Westen als Islamischer Staat IS bekannt – und der libanesischen Armee. Und unterhalten uns in Beirut mit Bürgerinnen über den Alltag in einem Land, in dem Irrsinn Normalität ist. Das oft keine Wahl hat – und jetzt gewählt hat.
Der Erbe: Michel Moawad
Michel Moawad kam 1996 aus Paris nach Beirut zurück, um das Erbe seines Vaters anzutreten. René Moawad war sieben Jahre zuvor, am 22. November 1989, kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten des Libanons, ermordet worden. Sein gepanzerter Wagen von einer 250-Kilo-Bombe in zwei Teile gerissen. Moawad war einer der Väter des Taif-Abkommens, das einen Monat zuvor den Bürgerkrieg beendet hatte.
Sein Sohn empfängt im Anzug in der Familienresidenz in Hazmiyeh, einem Vorort Beiruts im Mount-Lebanon-Bezirk. Ein Butler bringt starken Kaffee und gezuckerte Mandeln. Im Salon nebenan baut eine TV-Crew die Kulisse für ein Interview auf. Moawad ist gefragt, als Sohn einer Politikdynastie und treibende Kraft hinter der Zedernrevolution. Die Massendemonstrationen nach der Ermordung von Premierminister Rafiq Hariri 2005 hatten zu einem Ende der syrischen Besatzung geführt. Vom Wintergarten der Moawads sieht man über ganz Beirut, bis zum Mittelmeer. Orientteppiche bedecken den Steinboden. Vasen, Artefakte, Möbel, das ganze Haus strahlt den diskreten Reichtum einer alten Dynastie aus.
Als der Bürgerkrieg begann, war Moawad drei Jahre alt. Anders als viele Kinder reicher Familien durfte er erst am Ende des Bürgerkrieges ins Ausland. Seine Eltern sahen es als Bürgerpflicht an, im Land zu bleiben, solange es ging. Sein Vater war einer der wenigen, die alle Kriegsparteien akzeptierten. «Zwei Autos konnten alle feindlichen Linien passieren: jenes vom Roten Kreuz und jenes von René Moawad», erinnert sich Michel Moawad. «Er glaubte an Souveränität, staatliche Institutionen, ein vereintes Libanon und eine gute Beziehung mit den Nachbarn.»
Im Libanon
Mona Fahmy, mit elf Jahren als Tochter einer Schweizer Geschäftsfrau im Libanon kurz vor dem Bürgerkrieg in die Schweiz übergesiedelt, zerlegt die mächtigen Politdynastien des Landes in verständliche Einzelteile und erläutert in unserer Serie auch die Machtstrukturen der ganzen Region.
Die Golfstaaten, die Maghreb-Länder und der Westen standen hinter dem Abkommen von Taif. Der Iran war dagegen, «war aber damals noch kein grosser Player». Dagegen waren auch die Allianz von Saddam Hussein im Irak und Yassir Arafats PLO. «Die Palästinenser wollten eine Lösung für die ganze Region, nicht nur für den Libanon.» Die Syrer spielten ein doppeltes Spiel. «Sie sagten, sie seien für Taif, wollten aber etwas anderes als die internationale Lösung, die mein Vater vertrat.»
1989 reiste Michel Moawad nach Paris. Sein Vater hatte es erlaubt. Der Sohn sollte für die Matur den Kopf frei haben, während der Vater an der Zukunft des Libanon schmiedete. Am 4. November sahen sie sich in Paris zum letzten Mal. «Er sagte mir, er werde wahrscheinlich zum Präsidenten gewählt und danach würde es gefährlich.»
Am 5. November wurde René Moawad Präsident. Die Sowjetunion war am Zerfallen. Michel Moawad reiste nach Berlin an ein Konzert von Pink Floyd. Und war dabei, als die Mauer fiel. Sein Vater traf derweil eine syrische Delegation. Sie nannten ihm Namen für Ministerposten. «Man erzählte mir, dass alle mit steinernen Gesichtern aus dem Treffen gekommen seien.» Moawad hatte sich geweigert, nach ihrer Pfeife zu tanzen.
Keine zehn Tage später wird er getötet.
«Das Auto meines Vaters war komplett zerstört», sagt Michel Moawad. Die Technik dahinter war nicht alltäglich. Der Sprengsatz von der Grösse her damals ungewöhnlich. Mercedes wollte eine Untersuchung. Die Behörden nicht. Dann stahl jemand die Überreste des Wagens aus der Polizeistation. «So etwas geht nicht einmal mit Bestechung», sagt Moawad. «Das geht nur, wenn eine grosse politische Macht dahintersteht.» Syrien? Als Familie habe man nicht auf Syrien zeigen wollen, es gab noch andere, die Moawads Tod wollten. Der Irak und die Palästinenser etwa. Oder der Iran.
Wie bei der Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafiq Hariri fünfzehn Jahre später sind die Täter bis heute nicht bekannt. Die Syrer wollten keine Untersuchung. «Wäre es der Irak oder die PLO gewesen, es hätte bestimmt eine gegeben», sagt Moawad. Er war im Clinch. Vergessen und nach vorne schauen? Das Erbe seines Vaters annehmen? Er entschied sich fürs Erbe. Seine Mutter Nayla war da bereits Parlamentarierin, später wurde sie Sozialministerin. Am Sonntag wurde Michel Moawad ins Parlament gewählt. Die Mutter hatte ihn unterstützt, ebenso seine Frau und seine vier Kinder. Angst um sein Leben? «Als Politiker im Libanon muss man das Risiko akzeptieren.»
Die Premierminister
Rafiq Hariri
Rafiq Hariri starb am 14. Februar 2005. Bei einem Bombenanschlag auf der Corniche, beim St-Georges-Hotel. 1800 Kilogramm TNT sprengten den gepanzerten Wagen und rissen weitere 22 Menschen in den Tod.
Am Tatort steht heute der Rafiq Hariri Memorial Garden. Darin eine sechs Meter grosse Bronzestatue Hariris. Jeden Tag um 12.55, der Uhrzeit des Attentats, erklingen Kirchenglocken und der Ruf des Muezzins zum Gebet. Christen und Muslime, im Tod vereint. Auf der anderen Seite der Strasse liegt die Zaitunay Bay, darin ankern einige Jachten. Früher waren es mehr. An einer Mauer sind Bilder aus den 1960er- und 70er-Jahren zu sehen. Frauen in Bikinis auf Wasserski, Jachten – die goldenen Zeiten der Saint George Bay.
Hariri habe «grosse Ideen für den Libanon» gehabt, sagt der Journalist und Nahostkenner Robert Fisk. «Er wollte das Land nach dem Bürgerkrieg aufbauen.»
Der Milliardär wuchs in vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen auf, in einer sunnitischen Familie in der libanesischen Hafenstadt Sidon. Der Aufstieg gelang in Saudiarabien, wo seine Firma Saudi Oger zur Konstruktionsfirma des Königshauses wurde. Und Hariri reich. 1989 ebnete er in Saudiarabien den Weg zum Abkommen von Taif. In den Wiederaufbau Beiruts investierte er Millionen. Zweimal war Hariri Premierminister, von 1992 bis 1998 und von 2000 bis Oktober 2004, vier Monate vor seinem Tod.
Für Hariris Ermordung sei die Hizbollah verantwortlich, stand für die USA schnell fest. Was Fisk bezweifelt. Die prowestliche «Allianz des 14. März» beschuldigt Syrien, während die prosyrische «Allianz des 8. März» und Syrien den Mossad verdächtigen. Der Uno-Bericht des Sonderermittlers Detlev Mehlis sprach von Hinweisen auf eine syrische Beteiligung am Anschlag.
Das Attentat war jedenfalls Auslöser der Zedernrevolution. Menschen jeglicher Religion strömten in Massen auf die Strassen Beiruts. Sie forderten ein Ende der syrischen Besatzung und eine neue Regierung. Mit Erfolg. Die letzten syrischen Soldaten verliessen am 26. April 2005 libanesischen Boden. Nach 29 Jahren. Und die prosyrische Regierung unter Omar Karami trat zurück.
Doch das Land kam nicht zur Ruhe. Dafür sorgten eine Reihe weiterer Attentate sowie Kämpfe zwischen der Hizbollah und der israelischen Armee. Am 12. Juli 2006 überquerten Hizbollah-Kämpfer die Grenze und entführten zwei israelische Soldaten. Mit ihnen sollte die Freilassung dreier Libanesen in Israel erpresst werden. Israel beschoss daraufhin den Libanon. Strassen. Infrastruktur. Den Flughafen. Ein Angriff auf ein dreistöckiges Haus in Qana, bei dem 27 Menschen, darunter 16 Kinder, starben, löste internationale Proteste aus.
Am 14. August kam es zu einem Waffenstillstand. Die United Nations Interim Force in Lebanon an der israelisch-libanesischen Grenze wurde auf 15’000 Mann aufgestockt. Auf israelischer Seite starben laut einem Bericht von Human Rights Watch 43 Zivilisten, auf libanesischer Seite 1109. Keine der Parteien hielt sich an alle Bedingungen des Waffenstillstands. Israelische Kampfjets fliegen nach wie vor täglich durch libanesischen Luftraum. Und die Hizbollah ist nach wie vor bewaffnet.
Saad Hariri
Saad Hariris politisches Engagement begann mit dem Tod seines Vaters. Seine «Zukunftsbewegung» führte die Zedernrevolution an und war eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung der prowestlichen «Allianz des 14. März», einer Koalition verschiedener politischer Gruppen, die einen unabhängigen Libanon wollen. Von November 2009 bis Juni 2011 war Saad Hariri zum ersten Mal Premierminister. Der Rücktritt von zehn Ministern wegen Streitigkeiten über ein Tribunal, das die Ermordung von Rafiq Hariri untersuchen sollte, führte zu einer Auflösung der Regierung.
Der prosyrische Najib Miqati wurde 2011 Hariris Nachfolger als Premierminister. Er trat zwei Jahre später zurück wegen «intensiven Drucks zwischen den Pro- und Anti-Assad Lagern», wie er gegenüber den Medien sagte.
2016 kehrte Saad Hariri als Premierminister zurück. Als er in die Fussstapfen seines Vaters trat, erwartete Saudiarabien, dass er die Hizbollah zügeln würde, schreibt Robert Fisk. «Aber er musste ein vereinigtes Libanon anführen und es nicht in einen weiteren Bürgerkrieg führen.» Zum Ärger der Saudi.
Am 3. November 2017 empfingen Saad Hariri nach seiner Landung im saudischen Riad Polizisten. Am Nachmittag hatte er einen Anruf erhalten, der saudische König Salman wünsche, ihn zu sehen. Einen Tag später trat er in einer Ansprache am saudischen Fernsehen als Premierminister des Libanons zurück. Dass es freiwillig geschah, kaufte ihm keiner ab.
Kronprinz Mohamed bin Salman habe versucht, den Einfluss der Schiiten im Libanon zu zerschlagen, und Hariri sei ein offensichtliches Ziel für die «Wut dieses gefährlichen jungen Mannes» gewesen, so Fisk. Er habe versucht, Bashar al-Assads schiitisches Regime zu zerstören. Erfolglos. Er löste einen Krieg gegen die Schiiten im Jemen aus. Eine humanitäre Katastrophe. Er versuchte, Katar für seine Nähe zum Iran abzustrafen. Und scheiterte. Also war der Libanon das logische nächste Ziel.
Ein Angriff, der gründlich misslang. Statt das Parlament aufzulösen und die Hizbollah-Minister den Wölfen zum Frass vorzuwerfen, standen die Libanesen geschlossen gegen die Saudi. Die Regierung verkündete, sie akzeptiere Hariris Rücktritt nicht. In den Strassen Beiruts hiess es «Kull na Saad», «Wir sind alle Saad». Nicht einmal Befürchtungen, Saudiarabien könnte die über 200’000 Libanesen im Land ausweisen und sämtliche Investitionen stoppen und damit die Wirtschaft abwürgen, konnten die Libanesen beirren.
Auf Intervention Frankreichs und Ägyptens hin konnte Hariri mit seiner Familie in den Libanon zurückkehren, wo er offiziell seinen Rücktritt auf unbestimmt verschob. Und nun wieder kandidierte. Mit Erfolg. Zwar hat Hariris Zukunftsbewegung nur noch 21 statt bislang 33 Sitze, dennoch wird der vom Westen unterstützte Kandidat vermutlich seine dritte Amtszeit antreten: Der Premierminister im Libanon muss ja Sunnit sein, und die Zukunftsbewegung ist weiterhin die stärkste sunnitische Partei. Gegenüber Medien sagt Hariri, dass sie natürlich «lieber drei bis vier Sitze mehr gehabt hätten, aber es ist nicht das Ende der Welt». Und er fügte an: «Ich reiche allen Libanesen die Hand, um zur politischen Stabilität und zur Verbesserung der Lebensbedingungen aller Libanesen beizutragen.»
Die Flüchtlinge
Kurvenreich zieht sich die Strasse nach Bar Elias, einer der grössten Städte im Bekaa-Tal, auf halbem Weg von Beirut nach Damaskus, zehn Minuten von der syrischen Grenze entfernt. Am Radio singt der libanesische Sänger Assi El Hallani «Beirut Aam Tebky» – Beirut weint. Sein Remix zum Attentat auf Rafiq Hariri. Der Fahrer singt mit. In den Nachrichten: Ein israelischer Kampfjet hat am Morgen Syrien aus dem libanesischen Luftraum heraus beschossen.
Beladene Pick-ups, Motorräder und Wagen auf dem Weg zur Grenze kreuzen schwere Lastwagen. Am Strassenrand verkaufen Händler Bananen, Orangen, Grapefruits und Süsskartoffeln. Auf beiden Seiten des Bekaa-Tals sind schneebedeckte Berge, der Mount Lebanon und der Anti Lebanon, die natürliche Grenze zu Syrien. Dort sind Anfang Jahr 15 Syrer auf der Flucht vor dem Daesh erfroren. Sie waren teilweise in Plastiksandalen unterwegs. Nur ein Mädchen überlebte, mit schweren Frostbeulen im Gesicht.
Die Fahrt führt an einem Checkpoint vorbei, bei dem kürzlich Daesh-Kämpfer Armeeangehörige schwer verletzt hatten. Der Daesh ist seit Ausbruch des Syrienkrieges vermehrt im Libanon aktiv, vor allem im Norden. In der Grenzregion um Arsal fanden 2017 mehrmals Kämpfe zwischen der Armee und Angehörigen der Daesh und weiterer Terrorgruppen statt. Im August verliessen mehrere Busse mit Angehörigen der Nusra-Front die Stadt Arsal Richtung Syrien. Die Armee stiess darauf weiter nördlich vor, um sich die Daesh-Kämpfer vorzunehmen.
Rund um Bar Elias leben 100’000 syrische Flüchtlinge, aufgeteilt in kleinere Camps. Grosse Camps sind tabu. Von libanesischem Boden aus soll es nicht noch einmal zu einem Widerstandskampf kommen.
Vier Jahre, zwei Monate und drei Tage lebt Wael Yussef schon in einem behelfsmässigen Wellblechbau in der Nähe von Bar Elias, zusammen mit seiner Frau Samaher und den drei Kindern. Er sitzt auf einem abgetretenen Teppich, zählt jeden Tag.
Sie flohen aus Houla, einem Dorf nordwestlich von Homs. 370 Kinder waren bereits zu Tode gebombt worden. Yussef beschloss zu gehen. «Wir hatten nichts mehr zu essen, die Kinder weinten. Irgendwann hältst du es nicht mehr aus.»
Er hatte ein eigenes Geschäft, arbeitete als Innendekorateur. Möbel, Vorhänge, es lief gut. Alles wurde zerstört, gestohlen. «Es waren die Rebellen», sagt er. «Die sogenannte Opposition.»
Das Dach der Unterkunft ist undicht. Wasser dringt in die Zelte. «Im Winter ist es wie in einem Kühlschrank. Die Kinder sind oft krank.»
Die Versorgung der Flüchtlinge kann der Libanon nicht allein gewährleisten. «Internationale Vereine spenden den NGOs im Libanon viel Geld, damit sie sich um die syrischen Flüchtlinge kümmern», sagt der Zahnchirurg Michel Jazzar. Mit dem Hintergedanken, dass die Flüchtlinge dann nicht in andere Länder ziehen. Jazzar ist Mitglied in einem Rotary Club, leistet zusammen mit anderen Mitgliedern der Serviceorganisation Freiwilligenarbeit in den Camps. Sie untersuchen die Flüchtlinge unentgeltlich. Sie koordinieren Spenden, dank denen Schulkinder sauberes Wasser, Nahrung und Schulbücher haben.
Ein paar Meter weiter, in einem Container, unterrichtet Nur ein Dutzend Kinder. Mathe. Arabisch. Englisch. Obwohl sie selber kein Englisch kann. Sie hat Computerwissenschaften studiert, arbeitete in der Nähe von Damaskus als Architektin. Lehrerin, das gibt ihr hier etwas zu tun. Die Kinder sitzen auf farbigen Plastikstühlen. Sie kommen aus Homs und Damaskus. Wie Ahmad. Er ist acht. Sein Held ist Batman. Er will auch Lehrer werden. «Einige Kinder sind traumatisiert und gewalttätig», sagt Nur. Viel wichtiger, als das Einmaleins beizubringen, sei, ihnen einen normalen Alltag zu ermöglichen.
Was immer das heisst. Die Mädchen werden heiraten. So früh wie möglich. Zu jung. Viele Mütter im Camp sind knapp zwanzig, haben schon drei, vier Kinder. Sie liegen in Tüchern am Boden, spielen mit ernsten Gesichtern im Schutt. Die älteren Mädchen tragen Kopftuch.
Und einige prostituieren sich. Erst kürzlich hat die Journalistin Roula Douglas auf dem Heimweg gesehen, wie zwei syrische Flüchtlingsmädchen sich einem Libanesen anboten. Um zwei Uhr morgens. «Ich habe wie wild gehupt.» Der Mann sei dann weggefahren. Die Mädchen? «Sie werden sich wieder prostituieren. Ihre Familie braucht das Geld.»
Der Ökonom: Charbel Nahas
«Der Libanon hat keine Strategie für das Management der syrischen Flüchtlinge», sagt Charbel Nahas bei einem Treffen in seinem Büro in Achrafieh. Der ehemalige Telekommunikations- und Arbeitsminister hat als Ökonom sowohl die Weltbank wie die Uno beraten. «Die Flüchtlingsfrage lediglich als humanitäres Problem zu sehen, scheint mir naiv, ja sogar gefährlich.» Man müsse die Konsequenzen kennen und ansprechen. Die humanitäre Versorgung einer so grossen Anzahl Menschen ist für ein kleines Land, das eigene Probleme hat, schon schwer. Die Konsequenzen könnten den Libanon aber aus dem fragilen Gleichgewicht bringen. Etwa den angespannten Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Zu Hunderten übernehmen Flüchtlinge Jobs zu Dumping-Preisen. Oder für die innere Sicherheit. Daesh-Kämpfer versteckten sich unter den Flüchtlingen. Seit sieben Jahren sind die syrischen Flüchtlinge im Land. Viele Libanesen verlieren langsam die Geduld.
Nahas trägt Jeans und einen Sweater, serviert den Kaffee selber. Sein Arbeitszimmer erinnert an die Bibliothek der Oxford-Universität. Hohe Regale voller Bücher stehen an zwei Wänden, mit einer Leiter. Er liest viel, und er philosophiert gern, liebt es, andere zum Denken anzuregen. Ein Gespräch mit ihm plätschert nicht einfach so dahin.
Als Minister war er kein Bequemer. Er setzte sich 2011 für die Schwächeren ein, zum Missfallen des Establishments. Er forderte beispielsweise eine Mindestlohnerhöhung für Gastarbeiter. Das Parlament stimmte dagegen. Nahas ging vor die Shoura, das Verwaltungsgericht, das die Abstimmung für illegal erklärte. Er verlor dennoch, da die Regierung einen Weg fand, sein Projekt zu torpedieren. Nahas trat zurück.
Nun kandidierte er für die von ihm gegründete unabhängige Bewegung «Mouwatinoun wa Mouwatinaf fi Dawala», was so viel heisst wie: «Bürger in einem Staat», zusammen mit fünf Frauen und fünf Männern. Seine Konfession, Christ, gab er im Kandidatenprofil nicht an. Es sei an der Zeit, den alten Zopf mit den Religionszugehörigkeiten abzuschneiden. Doch die Libanesen sind noch nicht so weit. Ersten Ergebnissen zufolge gehört Nahas nicht zu den gewählten Parlamentariern.
«Die Wahlen, das ist alles ein netter Karneval», sagt er. Ein Ritual, das die Menschen unterhalte. Man könne Familienmitgliedern nette Posten zuschanzen und öffentlichkeitswirksam debattieren. Es sei an der Zeit, «den Zirkus in eine echte Machtübergabe umzuwandeln».
Nahas Bewegung forderte ein tragfähiges Gesundheitssystem für alle, einen Zivilstaat ohne konfessionelle Politik und Quoten und gleiche Rechte für Frauen. Ein effizienter Staat mit effizienten Strukturen stehe in der Pflicht, die Interessen seiner Bürger zu schützen und mit dem Ausland mutig und realistisch zu verhandeln. «Ohne Hintergedanken und Scheinheiligkeit.»
Natürlich habe der Libanon viel Einmischung von aussen erlebt. Interessant sei aber, zu ergründen warum. «Schwache Institutionen rufen das herbei», sagt er. Sie liessen den Bürger in seinen Ängsten allein. Das begünstige Gewalt. Die Institutionen verlören ihre Legitimation, was andere Länder ermutigt habe, religiöse Strömungen zu instrumentalisieren.
«Wir wagen es aber immer noch nicht, einen funktionierenden Staat aufzubauen.» Die Situation beschreibt Nahas als «Post-Krieg und Pre-Staat». Ein untragbarer Zustand. «Dieses Land steht kurz vor dem Bankrott.» Vier weitere Jahre Establishment «könnten es ruinieren».
Die Bürgerinnen
Der Spieler
Libanesen kennen Krisen, sie sind sie gewohnt, sagt Roland El Khoury. «Wir sind Phönizier. Wir sind vielleicht crazy, wir haben aber die positive Energie, neu zu starten.» Das hat El Khoury mit dem Casino du Liban vor. Dort, wo in den 1960ern und 70ern Mächtige auf Reiche und Schöne trafen. Das Casino liegt 22 Kilometer nördlich von Beirut, mit Aussicht auf die Stadt und das Mittelmeer. Von hier oben sieht man sie nicht, die Abfälle am Strand, die marode Infrastruktur, die unzähligen Narben der Stadt.
Früher traten hier Duke Ellington und Julio Iglesias auf. Besucher waren Albert von Monaco, der iranische Schah, Aristoteles Onassis, Omar Sharif. Während des Krieges kamen keine Touristen mehr. 1996 bis 2005 liefen die Geschäfte wieder gut. Bis Rafiq Hariri ermordet wurde. Vor allem die Araber blieben weg. Besuchten Casinos in der Türkei und Zypern.
Das Casino litt unter hohen Steuern und Personalkosten. «Jeder Politiker wollte jemanden im Casino beschäftigen», sagt El Khoury. 1400 Mitarbeiter sind es derzeit. Als er Mitte 2017 zum CEO ernannt wurde – der CEO des Casinos ist traditionell Christ –, habe er die Regierung gebeten, die Steuern zu senken. Mit der Vetternwirtschaft habe er auch aufgeräumt, sagt er. Seine Hände spielen mit einem Rubik-Würfel.
Ob es ihm gelingen wird, die alten Zeiten wieder auferstehen zu lassen? Es muss! «Die Wirtschaft hängt vom Casino ab. Es ist eines der sichtbarsten Highlights für Touristen.»
Der Banker
Der Libanon müsse den Massentourismus wieder ankurbeln, sagt Samir Hammoud, Leiter der libanesischen Bankenaufsichtsbehörde. Er sitzt auf einem Ledersofa in seinem Büro in der Banque du Liban an der Hamra Street. Sein Schreibtisch aus massivem Holz ist aufgeräumt. Vor dem Bürgerkrieg kamen Touristen aus der ganzen Welt in den Libanon, nun vor allem aus arabischen Ländern. «Sie sind willkommen, aber das ist nicht der Libanon», sagt er. Der Libanon, das ist das Multikulturelle. Die Touristen aus allen Ländern und Himmelsrichtungen, die zusammen das Leben geniessen. «Wir müssen Hotels bauen, investieren, damit der Tourismus wieder boomt.»
Vor allem müsse die Regierung ernsthaft über öffentlich-private Partnerschaften nachdenken. Um Investitionen im Bereich Wasser, Strassen und Elektrizität anzuziehen. «Wir können auch den Markt der Nachbarländer bedienen», sagt Hammoud. «Den regionalen Markt, Syrien, Irak, Jemen. Der Libanon könnte eine grosse Rolle spielen.»
Wenn der Libanon die Auslandvermögen und die Devisenreserven verliere, stünden die libanesische Währung und das Land vor einem Kollaps. Die Regierung müsse endlich das Budgetdefizit senken, vorher könne man wenig ändern. «Die Instabilität in Syrien war ein Schlag auf unseren Kopf.» Egal ob man gute oder schlechte Beziehungen zum Regime habe. «Es ist das Gate zur arabischen Welt, der einzige Nachbar, der nicht Israel ist.»
Der Libanon sei auch abhängig von guten Beziehungen zu regionalen und internationalen Mächten. Nur so könne sich die Wirtschaft positiv entwickeln. «Wir müssen aufstehen und ihnen sagen: Wir sind mit euch, kämpfen aber nicht euren Kampf.»
Die Lehrerin
«Wir wissen nicht, wie man ein normales Leben lebt», sagt Ghada Jabak beim Treffen im «Urbanista» an der Bliss Street, nahe der American University. In ein paar Stunden werden sich die Bars und Restaurants der Innenstadt füllen. Gespräche. Lachen. Musik. Und viel Alkohol.
Jabak ist Autorin und Lehrerin an der Libanesischen Universität. Wie viele Libanesinnen der Mittel- und Oberschicht hat sie Stil. Gepflegte manikürierte Hände, dezentes Make-up.
Der Libanon hat massive Probleme, sagt sie. Die grassierende Korruption. Die Umweltverschmutzung. Der Libanon erlebt seit einigen Jahren eine Müllkrise. In manchen Strassen türmt sich der Abfall. Die vorhandenen Deponien haben keine Kapazität mehr. Der öffentliche Verkehr ist praktisch inexistent. Das private Netz in lamentablem Zustand. Die Infrastruktur marode. Bei heftigem Regen kommt es sofort zu Überschwemmungen, und das Abwasser fliesst ungefiltert ins Meer.
Die Kriminalität ist hoch. Diebstahl, Tötungsdelikte. Häusliche Gewalt an der Tagesordnung. Ein bis zwei Frauen sterben durchschnittlich im Monat. Die Menschen verlieren schnell die Kontrolle. In Achrafieh wurden Fahrer schon mit dem Messer erstochen, wegen Verkehrsstreitigkeiten.
«Man müsste Beruhigungsmittel ins Trinkwasser giessen», sagt Ghada Jabak. Die seelischen Wunden des Krieges seien nie verheilt. Die vielen exzessiven Partys der Libanesen: Kompensation.
Stromausfälle bis zu sechs Stunden seien normal, ausser man zahle 60 US-Dollar im Monat für einen privaten Anbieter. Die staatlichen Schulen haben einen schlechten Ruf. «Wer kann, schickt seine Kinder auf Privatschulen.» An der American University of Beirut kostet das Semester 11’000 US-Dollar pro Kind und Jahr. Viele arbeiten in mehreren Jobs, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Wie Jabak. Sie hat vier Töchter. Zwei sind in Paris, eine kurz vor dem Anwaltsexamen, eine im Psychologiestudium.
Sie glaubte nicht, dass die Wahlen etwas ändern würden. «Man wird für die gleichen Leader stimmen. Die Leute vergessen. Sie sind wie hypnotisiert. Es geht nur ums Überleben.»
Sie wollte schon nach Kanada auswandern, aber etwas hält sie zurück: die Libanesen. Trotz allem sei es im Libanon besser als anderswo. Die verschiedenen Religionen und Gruppen? Fluch und Segen zugleich. Aber die Menschen kümmern sich umeinander. Nicht nur aus Gastfreundschaft. «Und wir finden immer eine Lösung.» Wie 1982, während der israelischen Invasion, als der Strom ausfiel. Die Leitung zerbombt. Just als ein Spiel der Fussball-WM lief. «Wir legten das Kabel aus dem Fenster auf eine Autobatterie, liessen den Motor laufen und schauten das Spiel.» Die ganze Nachbarschaft vor einem Schwarzweiss-Fernseher. Natürlich haben sie jedes Tor gefeiert. Die Freude am Feiern, der Erfindergeist, die Resilienz, das Aufstehen, auch wenn man immer wieder zu Boden geworfen wird. Das zeichnet die Menschen im Libanon aus. Unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrer Religion. «Libanesen erkennst du überall.»
Nach den Wahlen
Am Sonntag, 6. Mai, hat das Land gewählt. Es waren die ersten Parlamentswahlen seit 2009. Für eine vierjährige Amtszeit. Zwei Mal waren die Wahlen verschoben worden. Aus Sicherheitsbedenken wegen des Syrienkriegs. Weil das Land vorübergehend keinen Präsidenten hatte. Und um das neue Wahlgesetz zu finalisieren. Die 128 Sitze werden zwar nach wie vor je hälftig von Christen und Muslimen besetzt. Zum ersten Mal wählten die Libanesen allerdings nach dem Verhältniswahlrecht. Und nicht nach dem Mehrheitswahlrecht, das immer dieselben Dynastien an die Macht brachte. Auch kleinere Parteien und unbekanntere Personen sollten Sitze im Parlament gewinnen, so die Hoffnung vieler. Zum ersten Mal konnten auch Auslandslibanesen ihre Stimme abgeben. Von den ursprünglich 976 registrierten Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich noch 597 der Wahl, auf 77 Listen, in 15 Wahlbezirken.
Desillusioniert. Vom neuen Wahlrecht überfordert. So kommentieren einen Tag nach der Wahl libanesische Medien die tiefe Wahlbeteiligung von 49,2 Prozent. Die Wahl brachte keine Überraschungen. Wahlsiegerin ist die Koalition der schiitischen Hizbollah und Amal zusammen mit der christlichen Courant patriotique libre CPL (Freie Patriotische Bewegung) von Präsident Michel Aoun. Sie dürften 67 der 128 Sitze besetzen. Trotz Verlusten bleibt Saad Hariris Zukunftsbewegung stärkste Einzelfraktion, womit Hariri erneut Premierminister werden dürfte. Zugelegt haben die Forces Libanaises, die christlichen Nationalisten. Und da und dort doch neue Gesichter. Zum Beispiel eine unabhängige Kandidatin, die ehemalige TV-Moderatorin Paula Yacoubian.
Die neue Regierung hat viele Herausforderungen zu meistern. Die Müllkrise, die marode Infrastruktur, die serbelnde Wirtschaft, die 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge, die Palästinenser, die bewaffnete Hizbollah und somit faktisch nach wie vor zwei Armeen im Staat. Dies alles im Pulverfass Nahost.
Der Libanon steht einmal mehr zwischen den Fronten. Syrien und der Iran auf der einen, Israel, unterstützt von den Saudi und den USA, auf der anderen Seite. Sie werden alle Hebel in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass die Schiiten an Einfluss gewinnen. Als der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu am 30. April verkündete, er habe «Beweise», dass der Iran an Atomwaffen arbeite, glaubte ihm kaum jemand. Die israelische Zeitung «Haaretz» schrieb, Netanyahu habe keine «smoking gun», einen stichhaltigen Beweis, geliefert, sondern lediglich das vor Jahren aufgenommene Bild einer «smoking gun». Es sei vor allem eine Show gewesen, um US-Präsident Donald Trump zu beeinflussen, der bis am 12. Mai verkünden wird, ob die USA aus dem Atomdeal mit dem Iran aussteigen werden. Iran vermeidet derzeit eine Eskalation. Die Frage ist, wie lange noch.
In all diesem Irrsinn versuchen die Libanesen, ihren Weg zu finden. Und wählen statt dem Neuen dann doch wieder das Alte. Oder gar nicht. Diese Ambivalenz kommentiert die libanesische Tageszeitung «L’Orient-Le Jour» treffend: «Das eigentliche Problem ist, dass wir Libanesen die Wunde und der Balsam zugleich sind; die Krankheit und die Medizin; das Problem und die Lösung.»


