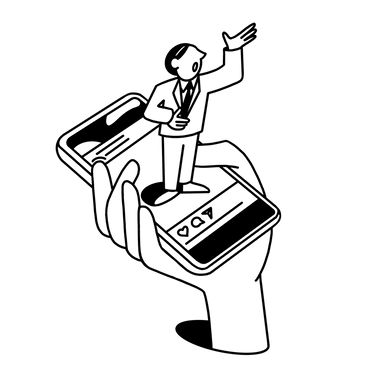
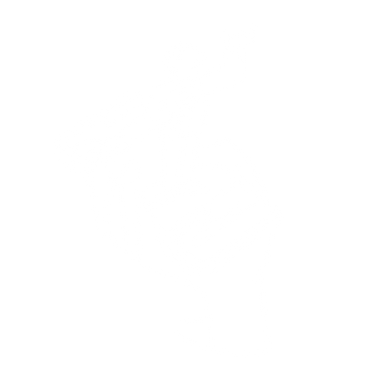
«Die Republik-Verleger und ich – wir sitzen im gleichen Boot»
Für Pietro Supino, Chef der TX Group, ist das Medienpaket kein Allheilmittel für die kriselnde Branche. Er will auch ein Leistungsschutzrecht und strengere Regeln für die SRG.
Ein Interview von Dennis Bühler (Text), Elena Xausa (Illustration) und Dan Cermak (Bilder), 03.02.2022
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Die Abstimmung über das Medienförderungsgesetz wird zur Zitterpartie: Gemäss der gestern veröffentlichten letzten Umfrage wollen 46 Prozent der Stimmbürgerinnen ein Ja in die Urne legen – und 49 Prozent ein Nein.
Ein zentraler Akteur hielt sich bisher eher im Hintergrund: Pietro Supino, der als Chef des grössten Schweizer Medienkonzerns TX Group und als Präsident des Verlegerverbands für die Annahme des Massnahmenpakets ist (und unfreiwillig landauf, landab von Plakaten der Gegner lächelt). Nun meldet er sich im Republik-Interview ausführlich zu Wort.
«Keine Steuermilliarden für Medienmillionäre» – so lautet der Slogan der Gegner des Medienförderungsgesetzes. Verstehen Sie den Ärger darüber, dass die hochprofitable TX Group vom Staat mit Dutzenden Millionen Franken unterstützt werden soll?
Dieser Slogan gehört zu einer Abstimmungskampfrhetorik, die mich ärgert. Allerdings sind solche Töne im Vorfeld von Volksabstimmungen nichts Neues. Für mich ist entscheidend, was das Medienpaket beinhaltet und warum es eine gute Sache ist.
Die vier grossen Schweizer Verlage TX Group, CH Media, Ringier und NZZ erzielten von 2011 bis 2020 Betriebsgewinne von 3,8 Milliarden Franken. Sogar im schwierigen Corona-Jahr 2020 verdienten sie über 300 Millionen Franken. Es ist doch stossend, wenn der Staat derart profitablen Unternehmen unter die Arme greifen muss?
Ich kann nur für mein eigenes Unternehmen sprechen, und da war es in den letzten Jahren wirtschaftlich schwierig.
Sie haben Ihren Aktionären für 2021, 2022 und 2023 eine Sonderdividende von je 44,5 Millionen Franken angekündigt.
TX ist eine diversifizierte Medien- und Technologiegruppe, die auf mehreren Säulen steht. Die Sonderdividende ergibt sich aus dem Verkaufserlös im Zusammenhang mit der Gründung der Swiss Marketplace Group. Das Unternehmen Tamedia, in dem wir das Geschäft mit der bezahlten Publizistik gebündelt haben, leidet stark. Für diesen Bereich und die gesamte Branche ist das Medienpaket wichtig, weil es gute Voraussetzungen schafft, um die Transformation zu bewältigen. Und zwar so, dass die ganze Bevölkerung mitgenommen werden kann.
Pietro Supino ist seit 2007 Verleger und Verwaltungsratspräsident des grössten Schweizer Medienkonzerns. Unter seiner Führung diversifizierte sich das Unternehmen derart stark, dass Journalismus heute nur noch eine untergeordnete Rolle spielt – und die Umbenennung von Tamedia in TX Group vor gut zwei Jahren nichts als folgerichtig war. Zur TX Group gehören florierende digitale Plattformen wie Jobcloud, Ricardo, Homegate und Tutti, die Werbevermarkterin Goldbach Group, die Gratiszeitung «20 Minuten», das leistungsstärkste Druckzentrum der Schweiz und mehr als ein Dutzend kostenpflichtige Tages- und Wochenzeitungen, die in der Sparte «Tamedia» zusammengefasst sind (darunter der «Tages-Anzeiger», die «Berner Zeitung», der «Bund», die «Basler Zeitung», «24 Heures», die «Tribune de Genève» und die «SonntagsZeitung»).
Der studierte Ökonom und Jurist mit Anwaltspatent führt das Unternehmen in fünfter Generation. Daneben hat er weitere Funktionen inne. Die beiden wichtigsten: Seit 2016 ist er Präsident des Verbandes Schweizer Medien und damit höchster Verleger. Und seit 2020 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der führenden italienischen Mediengruppe Gruppo Editoriale, die unter anderem die Tageszeitungen «La Repubblica» und «La Stampa» herausgibt.
Supino ist 56-jährig, schweizerisch-italienischer Doppelbürger, verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt in Zürich. Im Rahmen der vor einem Jahr publizierten «Tamedia Papers» widmete die Republik seinem Werdegang einen ausführlichen Beitrag mit dem Titel «Die Rache des Pietro Supino».
Das Zeitungsgeschäft war jahrzehntelang lukrativ. Nun muss der Staat einspringen, weil die Verleger die digitale Transformation verschlafen haben.
Im Gegenteil: Die Schweizer Verlage haben massiv in die digitale Transformation investiert – und tun es weiterhin.
Offenbar erfolglos, wenn Sie nun nach dem Staat rufen.
Das sehe ich anders. Auf den Redaktionen und in den Verlagen wurden grosse Fortschritte erzielt. Die grösste Herausforderung ist die Transformation des Abomodells: Die Leserinnen und Leser müssen Zahlungsbereitschaft für Onlinejournalismus entwickeln, wie wir sie für die gedruckte Zeitung kennen. Die Corona-Krise hat uns dabei sogar geholfen, weil sie das Bewusstsein für einen hintergründigen, einordnenden Journalismus gestärkt hat. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Das Massnahmenpaket zugunsten der Medien kommt namentlich jenen Leserinnen und Lesern zugute, die ihre Zeitung weiterhin in gedruckter Form lesen möchten.
Inwiefern?
Der wichtigste und finanziell bedeutendste Teil des Abstimmungspakets ist die indirekte Presseförderung. Dieses Geld fliesst nicht zu den Medienunternehmen, sondern zu den Vertriebsorganisationen, vor allem zur Post, die damit die Hauszustellung der Zeitungen verbilligen. Diese Unterstützung ist wichtig, weil wir bei den gedruckten Zeitungen schon seit vielen Jahren mit rückläufigen Auflagen zu kämpfen haben, was zu immer höheren Stückkosten führt. Wird die indirekte Presseförderung nicht ausgebaut, wird die flächendeckende Hauszustellung ausserhalb der Städte bald nicht mehr zu finanzieren sein.
Sie sind der mit Abstand mächtigste Verleger des Landes: Tamedia kommt in der Deutschschweiz auf einen Marktanteil von 46 Prozent und in der Romandie auf 69 Prozent. Verstehen Sie, dass man sich um die Medienvielfalt im Land sorgen kann?
Wie Sie diese Marktanteile berechnet haben, weiss ich nicht. Es stimmt aber, dass Tamedia ein starkes Unternehmen ist. Trotzdem fühle ich mich nicht als mächtiger Verleger.
Warum nicht?
Das liegt wahrscheinlich an unserer Unternehmenskultur. Wir verfolgen keine politischen Ziele. Bei uns ist Journalismus eine Dienstleistung für die Leserschaft und ein Geschäft, das wir möglichst gut machen möchten, indem wir uns an professionellen Standards orientieren. Macht ist für uns kein Ziel.
Wie beurteilen denn Sie die Medienvielfalt?
Sie ist gross, und sie ist in den letzten Jahren noch einmal gewachsen. Wann sind Sie geboren?
1986.
Ich bin zwanzig Jahre älter. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, erinnere ich mich an ein sehr überschaubares Medienangebot. Es war wie in den Restaurants, wo auf jedem Holztisch ein kleines metallenes Gestell stand mit Salz, Pfeffer, Maggi und Zahnstochern, und um 21 Uhr wurden die Trottoirs hochgeklappt. Dasselbe gilt für die mediale Welt: Es gab damals keine Sonntagszeitungen, keine privaten Radio- und TV-Stationen, das ausländische Medienangebot war nicht zugänglich. Und wenn Sie heute eine Tageszeitung von damals lesen, wirkt sie wie Knäckebrot.
Und heute?
Heute sind viele Tageszeitungen so reichhaltig, dass Sie sie aus Zeitgründen kaum zu Ende lesen können. Es ist eine breite Palette an neuen Medien hinzugekommen, von der Republik bis zu den kostenlos zugänglichen Onlineportalen, die von den Gegnern des Mediengesetzes betrieben werden. Das Medienangebot ist sehr vielseitig. Die wahre Herausforderung ist der grosse Wettbewerb. Die Leserschaft sieht sich der Herausforderung ausgesetzt, exzellente von minderwertigen Angeboten zu unterscheiden. Darum bin ich schon lange überzeugt, dass die Förderung der Medienkompetenz langfristig das wichtigste medienpolitische Anliegen ist.
Wenn man Ihnen zuhört, könnte man meinen: Der Markt funktioniert prächtig. Warum braucht es eine staatliche Intervention?
Der Markt funktioniert tatsächlich gut. Schwierig ist die Zukunft des gedruckten Medienangebots, weil die Vertriebskosten steigen. Wenn das Printangebot einbricht, verlieren wir einen Teil der Leserinnen und Leser. Das Ziel aber muss sein, alle mitzunehmen, um die Informiertheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.
Sie haben die Republik angesprochen. In einer Abstimmung unter den Verlegerinnen haben sich 90 Prozent für die Medienförderung ausgesprochen.
Ich glaube, Ihre Verlegerinnen und Verleger haben diese komplexe Fragestellung, zu der man im Einzelnen mit guten Gründen verschiedene Meinungen vertreten kann, richtig beurteilt. Es handelt sich um ein ausgewogenes Paket.
Der oberste Verleger des Landes begrüsst die Entscheidung der rund 25’000 Republik-Verlegerinnen?
So ist es, ich freue mich darüber. Wir sitzen im gleichen Boot.
Die Republik finanziert sich ausschliesslich aus dem Lesermarkt. Insgesamt aber wächst die Zahlungsbereitschaft für Onlinejournalismus in der Schweiz nur langsam – 2020 hat nur jeder sechste Erwachsene Geld dafür ausgegeben. Haben die Verleger Onlinejournalismus viel zu lange gratis verschenkt?
Im Nachhinein betrachtet: mit Sicherheit. Allerdings sahen und sehen wir uns im Internet neuer Konkurrenz ausgesetzt. Die SRG etwa nutzt ihre Gebührenfinanzierung, um nicht mehr nur ihr herkömmliches Radio- und Fernsehangebot zu produzieren, sondern im Internet zu expandieren. Und fast jedes Unternehmen stellt heute nebenher Medieninhalte her.
Woran denken Sie?
Ich mache Ihnen ein Beispiel: Eine Firma wie On, die Sportschuhe herstellt, ist heute auch im Storytelling tätig und damit in gewisser Hinsicht auch ein Medienunternehmen.
Darin sehen Sie eine Konkurrenz?
Ja. Wegen des riesigen Angebots wird es immer schwieriger, Leserinnen und Leser zu gewinnen, die bereit sind, für professionellen Journalismus zu bezahlen.
Ob vom Staat oder von Unternehmen: Interessengeleitete Kommunikation folgt keinen journalistischen Prinzipien, sie ist also etwa nicht der Wahrheitspflicht unterworfen. Glauben Sie, dass die Nutzerinnen zu wenig unterscheiden können und damit die journalistisch aufbereitete Information obsolet werden könnte?
Das macht mir Sorgen. Auch solche Angebote sind oftmals gut gemacht. Sie absorbieren Zeit und Aufmerksamkeit. Und sie sind eine Alternative zu Investitionen in Werbung, die historisch wichtigste Finanzierungsquelle für den Journalismus. Allerdings bietet die Entwicklung für uns auch eine Chance, weil sie unser Alleinstellungsmerkmal stärkt: die Unabhängigkeit.
Sie sagten aber 2017 der SRF-«Rundschau»: «Medienförderung führt immer zu Abhängigkeiten und zu einer Zementierung politischer Macht jener, die diese Gelder verteilen.» Ist Ihr Zitat schlecht gealtert?
Nein, diese Gefahr besteht. Beim jetzigen Massnahmenpaket wurde aber eine Lösung gefunden: Die indirekte Presseförderung ist so ausgestaltet, dass staatliche Einflussnahme ausgeschlossen werden kann. Sie hat sich seit der Gründung des Bundesstaates bewährt. Und die Onlineförderung orientiert sich am gleichen Mechanismus, indem sie an den im Lesermarkt erzielten Umsätzen anknüpft und somit das Publikum entscheidet, wer gefördert wird. Dieser Lösungsansatz, den unser Verlegerverband eingebracht hat, soll sicherstellen, dass die Unabhängigkeit der Redaktionen gewährleistet bleibt.
Die Onlineförderung war auch im Verlegerverband sehr umstritten. Vizepräsident Peter Wanner äusserte sich unmittelbar vor der entscheidenden Kommissionssitzung kritisch, auch Sie taten das wiederholt. Was störte Sie daran?
Neben der Frage der redaktionellen Unabhängigkeit, für die wir eine gute Lösung gefunden haben, beschäftigten uns zwei Fragen: Stellt die Förderung eine Wettbewerbsverzerrung dar? Und vor allem: Braucht es im Digitalen überhaupt eine Förderung, wenn wir es eher mit einer Über- als mit einer Unterversorgung zu tun haben? Es gab kontroverse Diskussionen, im Verband und in der Politik. Aber nun haben wir einen guten, ausgewogenen Kompromiss.
Stehen Sie vorbehaltlos dahinter?
Ja. Es liegt für mich im Wesen eines Kompromisses, dass man nicht mehr darüber diskutiert, wenn er einmal vorliegt.
Mit Ringier verzichtet einer der wichtigsten Grossverlage seit Jahren auf eine Mitgliedschaft im Verlegerverband. Welche Bedeutung hat der Verband für die Branche noch?
Er ist sehr wichtig. Ich habe mich persönlich für die Rückkehr von Ringier eingesetzt und bin zuversichtlich, dass diese nach der Volksabstimmung vollzogen wird. Der Grund für die Verzögerung war eine Differenz, inwieweit auch Zeitschriften vom Medienpaket profitieren sollten.
Sie haben kürzlich eine Verjüngung des Präsidiums in Aussicht gestellt und angekündigt, die Diversität zu erhöhen. Wie kriegen Sie das hin?
In Aussicht gestellt habe ich es nicht, schliesslich wird das Präsidium nicht vom Präsidenten zusammengestellt, sondern von den Mitgliedern gewählt. Es ist aber mein persönliches Ziel, von dem ich nun meine Kollegen überzeugen muss. Einige sind schon sehr lange dabei, es braucht in einer Institution aber immer wieder frisches Blut. In diesem Kontext habe ich angeregt, dass wir uns verjüngen und diverser aufstellen. Hierzu bin ich sowohl mit meinen Kollegen im Gespräch als auch mit verschiedenen Personen, die das Präsidium in Zukunft bereichern könnten.
Sie selbst wollen Präsident bleiben?
Ich bin auch schon lange dabei und kann mir gut vorstellen, meine Aufgabe zu übergeben.
Zurück zum Abstimmungskampf. Die Gegner des Massnahmenpakets argumentieren auch mit der Corona-Berichterstattung der Schweizer Medien, die gegenüber dem Bundesrat unkritisch gewesen sei. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Medien?
Was Schweizer Journalistinnen und Journalisten in den letzten zwei Jahren geleistet haben, ist ein Glanzlicht. Beeindruckt hat mich, dass es in der Anfangsphase der Krise gelang, die Leistung unter sehr schwierigen Umständen in der gewohnten Qualität aufrechtzuerhalten, wozu auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Druckereien, im Vertrieb und im Verlag sehr viel beigetragen haben. Das hat mich als Verleger mit Stolz erfüllt.
Und danach?
Die Medien fanden einen guten Umgang im Spannungsfeld: Zum einen galt es, gegenüber den handelnden Personen eine kritische Distanz zu wahren, zum anderen verlangte die Krisensituation eine verantwortungsvolle Berichterstattung. Namentlich im Datenjournalismus wurde hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben ein Savoir-faire weiterentwickelt, von dem wir auch in der Zukunft profitieren werden.
Das Referendumskomitee veröffentlichte vor rund einem Monat eine Videoaufnahme, auf der Ringier-CEO Marc Walder zu hören ist, der sagt, man wolle die Regierungen in der Krise unterstützen. Was dachten Sie, als Sie erstmals davon hörten?
Marc Walder hat sich dazu erklärt und entschuldigt, soweit seine Aussage unglücklich war. Dem muss ich nichts hinzufügen. Ich teile aber die Überzeugung, dass wir als Medienmacher eine gesellschaftliche Verantwortung tragen.
Was heisst das?
Für unser Haus habe ich zusammen mit Res Strehle im Handbuch «Qualität in den Medien» festgehalten, an welchen journalistischen Standards wir uns orientieren. Auf dieser Basis unterziehen wir unsere journalistische Leistung jährlich einem Qualitätsmonitoring.
Die Gegner des Massnahmenpakets sehen in Walders Aussage den Beweis für ihre These, dass die grossen Schweizer Medien mit den Mächtigen unter einer Decke stecken.
Dazu fällt mir eine Redewendung ein: «It’s politics, stupid.»
Was passiert, wenn das Mediengesetz bachab geschickt wird?
Ich bin zuversichtlich.
Gemäss Umfragen wird es knapp, aktuell scheinen die Gegner die Nase aber leicht vorne zu haben.
Die Schweizer Stimmbevölkerung hat immer wieder gezeigt, dass sie auch bei komplexen Fragestellungen vernünftige Entscheide fällt – deshalb bleibe ich zuversichtlich.
Und wenn es doch anders kommt?
Ohne Medienpaket wird die flächendeckende Hauszustellung der Zeitungen schneller nicht mehr aufrechtzuerhalten sein. Ein Teil der Bevölkerung wird sich weiterhin gedruckte Zeitungen leisten können, ein Teil wird auf digitale Angebote wechseln. Und einen dritten Bevölkerungsteil würden wir verlieren. Das wäre schlecht für die gesamte Gesellschaft.
Könnte einigen Redaktionen bei einem Nein am 13. Februar der Schnauf ausgehen?
Nein, das glaube ich nicht unmittelbar.
Starten Sie nach einer Niederlage an der Urne gleich den nächsten Anlauf, um doch noch einen Ausbau der staatlichen Medienförderung zu erwirken?
Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat gesagt, es gebe keinen Plan B. Es wäre nur schon wegen des langwierigen politischen Prozesses sehr schwierig, einen solchen zu entwickeln. Am naheliegendsten wäre wohl eine Reduktion des Medienpakets auf die weitgehend unbestrittene indirekte Presseförderung. Allerdings hat das Parlament diese Frage im Herbst 2020 ausgiebig debattiert und wollte genau dies nicht, sondern das umfassendere Medienpaket.
Heisst konkret?
Ich habe für das Nein-Szenario keine Lösung. Allerdings ist das Medienpaket allein auch nicht das Allheilmittel für die Medienbranche, auch wenn es ein sehr wichtiger Beitrag ist. Andere wichtige Komponenten sind die Einführung eines Leistungsschutzes, Investitionen in die Medienkompetenz sowie eine Klärung, inwieweit die SRG das private Angebot mit Gebührengeld konkurrenzieren darf.
In Interviews und Reden weibeln Sie seit Monaten für das Leistungsschutzrecht, mit dem Sie Google, Facebook und Co. zur Kasse bitten wollen.
Das Leistungsschutzrecht ist essenziell. Die globalen Plattformen betreiben ihr Geschäft mit journalistischen Inhalten, die sie von regionalen und nationalen Anbietern übernehmen. Es ist notwendig, dass sie auch einen Beitrag an deren Finanzierung leisten. Ansonsten kann diese Wertschöpfung langfristig nicht aufrechterhalten werden.
Mit der für ein Leistungsschutzrecht verantwortlichen Justizministerin Karin Keller-Sutter wissen Sie eine mächtige Verbündete an Ihrer Seite: An einem öffentlichen Anlass verglich die FDP-Bundesrätin Google und Facebook im November sogar mit «Velodieben». Sind Sie gleicher Meinung?
Diese Unternehmen sind marktmächtig. Jedes Schweizer Medienunternehmen muss sich mit ihnen arrangieren und ihre Konditionen akzeptieren. Aus kartellrechtlichen Gründen dürfen wir uns nicht gemeinsam wehren. Wir sind auf eine gesetzliche Grundlage angewiesen, die unsere Position stärkt und einen fairen Austausch mit den globalen Anbietern ermöglicht.
Die Verlage profitieren doch von der viel grösseren Reichweite, die sie dank Google und Facebook erhalten. Ist es nicht eine Win-win-Situation?
Doch, das ist es auch. Man spricht nicht umsonst von einer «Frenemy»-Beziehung.
Aber?
Der Austausch findet nicht auf Augenhöhe statt. Wir sind der Marktmacht ausgeliefert. Um unsere Inhalte zu finanzieren, müssen wir erreichen, dass die Plattformen, die damit ein grosses Geschäft machen, ihren Teil beitragen.
Im Ausland sind Versuche, den globalen Tech-Playern beizukommen, bisher grösstenteils fehlgeschlagen.
Das stimmt für die länger zurückliegende Vergangenheit. Die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre aber stimmt mich zuversichtlich: In Australien konnte die Marktmacht von Google und Facebook erfolgreich eingeschränkt werden, und in der Europäischen Union wurde die gesetzliche Basis für ein Leistungsschutzrecht geschaffen. In der Schweiz hinken wir hinterher.
Wann rechnen Sie mit Einnahmen aus dem Leistungsschutzrecht?
In drei bis fünf Jahren – 2026, optimistisch geschätzt.
Bevor Sie nun Google, Facebook und Co. den Kampf angesagt haben, hatten die Schweizer Verleger jahrelang eine «Frenemy»-Beziehung mit der SRG unterhalten. Wie ist das Verhältnis aktuell?
Auf einer persönlichen Ebene ist das Verhältnis gut. Wir privaten Verleger unterstützen, dass es die SRG gibt – sie ist ein wichtiger Pfeiler der Medienlandschaft und macht guten Journalismus. Das Problem ist, dass die SRG hohe Gebühren bekommt, die für Radio und Fernsehen gedacht sind, die sie aber anders einsetzt.
Was stört Sie konkret?
Anders als früher sind Radio und Fernsehen und das private Medienangebot heute keine getrennten Welten mehr, sondern durch die technologische Entwicklung verschmolzen. Die SRG hat aus den Gebühreneinnahmen sehr grosse Mittel zur Verfügung, die sie in ein kostenloses Onlineangebot investiert. Damit konkurrenziert und untergräbt sie die Geschäftsgrundlage der Bezahlmedien. Sie unterläuft die Transformation des Geschäftsmodells der privaten Medien und schwächt sie und letztlich die Medienvielfalt. Dies kann nicht der Sinn des öffentlich finanzierten Medienangebots sein. Es braucht eine Regulierung, die festlegt, wofür die SRG die Gebührengelder einsetzen darf.
Ist das, was die SRG tut, aus Ihrer Sicht eine missbräuchliche Zweckentfremdung der Gebührengelder?
Ja.
Vor der Abstimmung über die «No Billag»-Initiative hatte der Verlegerverband lange auf eine Parole verzichtet, um sich kurz vor Schluss dann doch noch dem Nein-Lager anzuschliessen. Nun hat die SVP eine Initiative angekündigt, mit der die Radio- und Fernsehgebühren entweder halbiert oder auf 200 Franken gesenkt werden sollen. Wie stehen Sie zu dieser Idee?
Im Verlegerverband haben wir diese Initiative noch nicht behandelt. Persönlich bin ich dafür, das Gespräch mit der SRG zu suchen, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wofür sie die Gebühreneinnahmen einsetzen darf. Sollten wir uns darüber nicht verständigen können, wird sich die Frage der Finanzierung stellen. Denn die grossen Investitionen ausserhalb von Radio und Fernsehen sind Ausdruck davon, dass die SRG dafür zu viel Geld zur Verfügung hat.
Sie liebäugeln mit der Unterstützung der Initiative.
Ich fände es für die Medienlandschaft in der Schweiz gewinnbringender, wenn wir eine offene Diskussion über die Gebührengelder und deren Einsatz führen und sicherstellen könnten, dass die Medienlandschaft damit nachhaltig bereichert wird.
Mit «20 Minuten» tun Sie selbst, was Sie der SRG vorwerfen: Sie kannibalisieren das eigene kostenpflichtige Angebot. Und Peter Wanner tut mit «Watson» das Gleiche.
Es scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Aber wir finanzieren diese Angebote nicht aus öffentlichen Geldern, sondern aus Werbeeinnahmen. Als Gegenstück zum Privileg der Gebührenfinanzierung schreibt die Bundesverfassung der SRG vor, auf die Stellung und die Aufgabe der privaten Medien Rücksicht zu nehmen. Ausserdem bietet «20 Minuten» einen anderen Journalismus als die Bezahlzeitungen. Deshalb kannibalisiert es sie auch nicht.
Worin unterscheidet er sich?
«20 Minuten» ist vergleichbar mit Radionachrichten, in denen das Wesentliche in Kürze journalistisch sauber berichtet wird: «20 Minuten» informiert, liefert aber keine Vertiefung, keine Einordnung, keine Recherche. Das ist nicht mit dem «Tages-Anzeiger», der NZZ oder der Republik vergleichbar, wo versucht wird, mit journalistischem Tiefgang einen Mehrwert zu schaffen, der sich nur mit einem Abomodell finanzieren lässt.
Mit anderen Worten: «20 Minuten» darf keinen guten Journalismus machen, weil es sonst dem «Tages-Anzeiger» das Wasser abgräbt?
Auch «20 Minuten» bietet guten Journalismus, aber auf eine andere Art: Es schafft andere Mehrwerte. «20 Minuten» ist eine Plattform, auf der sich die Bevölkerung austauscht, was viel mit einem Lebensgefühl zu tun hat und einen gesellschaftlichen Wert darstellt. Die Ausdifferenzierung wird weitergehen. Sie basiert auf Ideen, die direkt von den Journalistinnen und Journalisten sowie der Community eingebracht werden. Dies ist eine der grossen Stärken von «20 Minuten» und ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
Wie wichtig ist der Journalismus noch in Ihrem Konzern, der TX Group?
Sehr wichtig.
Historisch mögen Sie recht haben. Aber heute?
Das Wirken bei Tamedia, bei «20 Minuten», bei Goldbach und unseren Marktplatzbeteiligungen hat zum Ziel, die Bevölkerung zu informieren und zu orientieren. Daneben unterhalten wir auch und bieten Hilfestellungen für den Alltag. Im Kern geht es uns darum, Menschen zu befähigen, sich ihre eigenen Meinungen zu bilden. Das gilt im politischen genauso wie in anderen Bereichen, wenn beispielsweise jemand eine neue Wohnung oder eine neue Stelle sucht.
Salbungsvolle Worte. Finanziell brauchen Sie den Journalismus bei der TX Group aber nicht.
Im Moment ist der Journalismus kein Geschäft mehr. Aber ich bin überzeugt, dass er wichtig ist für die Gesellschaft und in Zukunft auch wieder zu einem Geschäft werden kann. Deshalb investieren wir in seine Transformation.
Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie eben nicht investieren, sondern Redaktionen auspressen wie Zitronen. Die «Bund»-Redaktion veröffentlichte im August 2018 ein Protestschreiben mit einer Frage und einer Feststellung: «Was tut Tamedia für die Qualität im Alltag? (…) Tamedia gebärdet sich als Firma, in der Geldgier das wichtigste Motiv zu sein scheint.»
Tatsache ist: Es gibt in der Schweiz kein Unternehmen, das so viel in den Journalismus investiert wie unsere Gruppe. Niemand beschäftigt so viele Journalistinnen und Journalisten wie wir, niemand bietet so gute Arbeitsbedingungen, und niemand investiert so viel in neue technologische Möglichkeiten im Journalismus. Die TX Group und Tamedia sind nicht nur in der Schweiz bemerkenswert, wir werden auch international als fortschrittliches Vorbild anerkannt.
Artur Vogel, von 2007 bis 2014 «Bund»-Chefredaktor, sagte in den vor einem Jahr von «Heidi News» und der Republik gemeinsam publizierten «Tamedia Papers»: «In der Öffentlichkeit erklärt Pietro Supino immer, er fühle sich dem Qualitätsjournalismus verbunden, aber mir gegenüber sprach er immer nur von Rendite. (…) Uns wurde finanziell die Luft abgeschnürt. Ich bin Journalist geworden, weil ich gerne schreibe, aber meine letzten Jahre im Beruf verbrachte ich damit, Geld zu sparen und Leute zu entlassen.»
Zu Herrn Vogel möchte ich mich nicht äussern. Sie können davon ausgehen, dass mein Einsatz für den Journalismus und meine Aussagen ehrlich sind.
Vogel und weitere Chefredaktoren störten sich an einem Ziel, das Sie vor bald zehn Jahren vorgegeben hatten: Jede Redaktion müsse eine Rentabilität von 15 Prozent erreichen.
Das war eine von vielen Zielsetzungen unseres Managements. Eine, die leider schlecht kommuniziert wurde und heutzutage von der Realität längst überholt ist.
Welchem finanziellen Ziel haben die Redaktionen denn heute zu genügen?
Im Moment müssen wir froh sein, wenn wir mit Tamedia nicht Verlust machen.
Wie lange nehmen Sie das in Kauf?
Wir befinden uns in einer kolossalen Transformation, während der wir neue Grundlagen für unabhängigen Journalismus schaffen müssen. Im Ausland ist man teilweise weiter: Grosse Beispiele wie die «New York Times», aber auch kleinere wie die Zeitungen der norwegischen Amedia-Gruppe zeigen, dass sich mit Journalismus auch in Zukunft ansprechende Renditen verdienen lassen und dass sich Investitionen lohnen.
Sie wehren sich seit Jahren beharrlich, Journalismus querzufinanzieren mit den Erträgen, welche die hochprofitablen anderen TX-Zweige liefern. Warum?
Journalismus ist für uns eine Wertschöpfung, die wir erbringen und die eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Nachhaltig ist das nur möglich, wenn am Ende die Erträge den Aufwand decken. Wir investieren, um ein Geschäftsmodell zu transformieren, das auf eigenen Füssen stehen kann.
Sie weichen aus. Was spricht gegen Querfinanzierung?
Die Unabhängigkeit ist das zentrale Qualitätsmerkmal unseres Journalismus. Zu Ende gedacht setzt inhaltliche Unabhängigkeit eine wirtschaftliche Unabhängigkeit voraus.
Querfinanziert wurde doch schon immer, etwa über Kleinanzeigen in den Zeitungen.
Die Kleinanzeigen gehörten früher zum Geschäftsmodell der Zeitungen. Dann haben im Zuge einer gewaltigen Disruption weltweit alle Zeitungen einen Grossteil der Anzeigen verloren, an neue, eigenständige Unternehmen, die völlig losgelöst vom Trägermedium Zeitung operieren und mit diesem nichts mehr zu tun haben. Wir haben bei Tamedia lange dagegen gekämpft, leider erfolglos.
Ihnen kann das ja egal sein, weil die TX Group eine Vielzahl solcher Marktplätze wie Homegate, Car4you, Tutti und Ricardo besitzt.
Als eines von wenigen Medienunternehmen hatten wir ab 2004 den Mut, in solche Start-ups zu investieren. Dies war riskant, und wir mussten auch einige Misserfolge hinnehmen. Heute aber haben wir ein Portefeuille, mit dem wir im nationalen und internationalen Vergleich sehr gut dastehen. Mit unseren journalistischen Aktivitäten haben diese Geschäfte nichts zu tun.
Gerade dieser Erfolg würde es Ihnen erlauben, den eigenen Redaktionen gegenüber etwas grosszügiger aufzutreten.
Die mit den digitalen Marktplätzen erzielten Erfolge sind nicht in Stein gemeisselt. Weil sie laufend mit neuen Disruptionen konfrontiert sind und wir in einem globalen Wettbewerb bestehen müssen, sind wir auch neue Allianzen eingegangen – zuletzt durch die Gründung der Swiss Marketplace Group zusammen mit Ringier, der Mobiliar und General Atlantic.
Sie sprechen die Zusammenlegung Ihrer Marktplätze mit der Scout24-Gruppe von Ringier an. Der Börsenkurs der TX Group ist daraufhin regelrecht durch die Decke gegangen, wovon in erster Linie Ihre Verwandtschaft profitiert. Was tut sie eigentlich mit dem ganzen Geld?
Für meine Familie hat der gestiegene Börsenkurs vor allem die Konsequenz, dass wir mehr Vermögenssteuern bezahlen. Weil wir langfristig an unser Unternehmen gebunden und von ihm beseelt sind, ändert der gestiegene Börsenwert für uns sonst nicht viel. Es gibt uns aber Sicherheit, dass die Entwicklung unseres Unternehmens positiv eingeschätzt wird.
In den vor einem Jahr veröffentlichten «Tamedia Papers» war zu lesen, man nenne Sie intern auch «the smiling knife». Erachten Sie diesen Spitznamen als passend?
Bei «smiling» hoffe ich es, bei «knife» hingegen wüsste ich nicht, warum.
Von der staatlichen Medienförderung, über die das Schweizer Stimmvolk 13. Februar abstimmt, würde auch die Republik profitieren. Wie viel Geld sie erhielte, ist derzeit unklar. Klar ist: Über die Frage, ob sie das Geld überhaupt annehmen würde, müsste die Verlegerschaft entscheiden. Genauso haben wir die Entscheidung, welche Parole Project R, die Genossenschaft hinter der Republik, zum Mediengesetz fassen soll, an die Verlegerschaft delegiert. Die Befragung ist abgeschlossen, hier finden Sie die Ergebnisse.