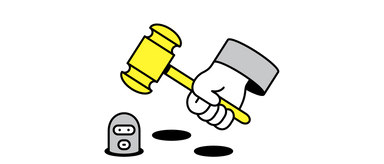
Sie war einmal Schweizerin. Doch das ist egal
Eine Belgierin soll das Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren, weil sie wirtschaftlich zu wenig integriert ist. Dabei wurde sie als Schweizerin in der Schweiz geboren. Wie kann so was sein?
Von Brigitte Hürlimann, 06.11.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Erst seit knapp 30 Jahren werden Schweizerinnen im Bürgerrechtsgesetz nicht mehr diskriminiert, und für Männer wie Frauen gelten die gleichen Bürgerrechtsregeln. Zwischen 1953 und 1992 mussten die Frauen bei der Eheschliessung mit einem Ausländer die Erklärung abgeben, Schweizerin bleiben zu wollen, sonst verloren sie den Schweizer Pass. Noch dramatischer und ungerechter war die Situation vor 1953: Damals verloren Schweizerinnen das Bürgerrecht automatisch, wenn sie einen Ausländer heirateten. Ganz anders der Fall bei Schweizer Männern, die Ausländerinnen heirateten: Sie behielten das Bürgerrecht – und ihre ausländischen Frauen wurden mit der Trauung automatisch Schweizerinnen.
Die diskriminierende Gesetzgebung hatte für viele Frauen gravierende Folgen, vor allem während des Zweiten Weltkriegs. Doch auch die Ungerechtigkeit der bis 1992 geltenden Erklärungsregel hallt bis heute nach. Das zeigt der Fall einer Belgierin am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, die aus der Schweiz weggewiesen werden soll: als wirtschaftlich zu wenig integrierte EU-Bürgerin, die jahrelang Sozialhilfe bezog.
Weder das Staatssekretariat für Migration (SEM) noch das Gericht sind der Ansicht, dass es dem gesunden Menschenverstand oder dem Gerechtigkeitsgefühl widerspricht, wenn eine Frau wegen einer früheren, diskriminierenden Gesetzgebung ihre alte Heimat verlassen muss. Beide Instanzen spulen den Fall nach den heute geltenden Gesetzen für EU-Bürger ab, foutieren sich ums Gesamtbild, schauen nicht zurück.
Das mag juristisch korrekt sein, aber ist es auch nachvollziehbar? Und wirklich die einzige Lösung für diesen Fall?
Ort: Bundesverwaltungsgericht St. Gallen
Datum: 20. August 2019
Fall-Nr.: F-4332/2018
Thema: Bewilligung des Aufenthalts aus wichtigen Gründen
Die Frau, um die es hier geht, ist heute 63 Jahre alt. Sie wird 1956 in der Schweiz geboren, als Kind von Schweizer Eltern. Als sie 10 Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. Die Mutter zieht mit ihrer kleinen Tochter nach Belgien, heiratet einen Belgier und verliert dadurch die Schweizer Staatsbürgerschaft – weil sie keine anderweitige Erklärung abgegeben hat. Ihre Tochter bleibt Schweizerin, bis sie ebenfalls heiratet: in Belgien, einen Belgier. Und wie zuvor schon die Mutter gibt auch sie keine Erklärung ab, weiterhin Schweizerin bleiben zu wollen.
Nach dem damals geltenden Bürgerrechtsgesetz verliert die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines Belgiers das schweizerische Bürgerrecht. Und, es kann nicht genug betont werden: Dieser komplett unterschiedliche Umgang zwischen Schweizerinnen, die Ausländer heiraten, und Schweizern, die Ausländerinnen heiraten, war frauendiskriminierend.
Das bestreitet eigentlich niemand.
1998 kommt eine Tochter der Beschwerdeführerin auf die Welt; in Belgien, als Belgierin. 2005 kehrt die Mutter mit dem damals 7-jährigen Mädchen zurück in die Schweiz, in den Kanton Waadt. Sie hält sich seither als EU-Bürgerin gestützt aufs Freizügigkeitsabkommen in ihrer früheren Heimat auf. Die Aufenthaltsbewilligungen werden regelmässig erneuert. Bis 2015, zehn Jahre nach ihrer Rückkehr.
Grund für die aufenthaltsrechtlichen Probleme: die andauernd schwierige finanzielle Situation der alleinerziehenden Mutter.
Der Belgierin fällt es schwer, beruflich und wirtschaftlich Fuss zu fassen, genug Geld für sich und ihre Tochter zu verdienen. Zwischen 2007 und 2016 bezieht sie rund 264’000 Franken an Sozialhilfe, das sind knapp 30’000 Franken pro Jahr. Das wird ihr nun zum Verhängnis, und das ist der einzige Grund, warum sie und ihre Tochter die Schweiz verlassen sollen. Dies, obwohl die heute 63-jährige Frau inzwischen eine 50-Prozent-Stelle gefunden hat und vom Kanton Waadt eine Überbrückungsrente bekommt. Und obwohl sich ihre Tochter noch in Ausbildung befindet und mit einem Stipendium unterstützt wird.
Und eben: Obwohl die Frau bis zum zehnten Lebensjahr als Schweizerin in der Schweiz lebte und sich seit ihrer Rückkehr aus Belgien vor 14 Jahren ununterbrochen hier aufhält. Macht insgesamt 24 Jahre in der Schweiz. Doch sowohl das SEM als auch das Bundesverwaltungsgericht halten eine Ausweisung von Mutter und Tochter als zulässig und zumutbar. Die Unterlegenen akzeptieren den Entscheid nicht und haben ihn vor Bundesgericht gezogen. Das höchstgerichtliche Urteil steht noch aus.
Hauptthema im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen ist die Frage, ob den beiden Belgierinnen eine Aufenthaltsbewilligung aus wichtigen Gründen erteilt werden kann. Wie zuvor schon das SEM verneint auch das Gericht die Frage – wegen der prekären finanziellen Situation beziehungsweise wegen der fehlenden wirtschaftlichen Integration. Die Voraussetzungen für eine Anwendung der Härtefallbestimmung von Artikel 20 der Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs lägen nicht vor.
Das Gericht schreibt: Dass die Beschwerdeführerin einmal Schweizerin gewesen sei, spiele in diesem Verfahren überhaupt keine Rolle: «ne joue aucun rôle».
Als langjährige Sozialhilfeempfängerin erfüllt die 63-Jährige weder die Voraussetzungen für einen Aufenthalt als Berufstätige noch als Nichtberufstätige, darum wird das Vorliegen wichtiger Gründe geprüft, die Anwendung der einschlägigen Härtefallbestimmung. Diese soll jedoch nur ausnahmsweise und unter sehr restriktiven Bedingungen zum Zuge kommen. Im Falle der 63-jährigen Ex-Schweizerin gelingt die Anrufung der Härtefallbestimmung nicht.
Zumindest vorerst nicht. Es bleibt abzuwarten, wie das Bundesgericht die Sache beurteilen wird.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte auch noch andere Möglichkeiten geprüft, ausserhalb des Freizügigkeitsabkommens, um der Belgierin und ihrer Tochter weiterhin einen Aufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen. Das dreiköpfige Gerichtsgremium erwähnt die Möglichkeit einer Wiedereinbürgerung, stellt aber fest, aus den Akten seien keine derartigen Bemühungen ersichtlich. Und es verweist von sich aus auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), konkret auf Artikel 8, der das Recht auf ein Privat- und Familienleben garantiert. Doch das Gericht sieht auch gestützt auf die EMRK keine Möglichkeit für einen Verbleib von Mutter und Tochter in der Schweiz.
Das Bundesverwaltungsgericht muss von Amtes wegen dafür sorgen, dass bei der Beurteilung eines Falls die richtigen Rechtsnormen angewandt werden. «Es ist also nicht an die rechtlichen Überlegungen der Parteien gebunden», sagt Rocco Maglio, Medienbeauftragter am Bundesverwaltungsgericht.
Schade, hat das Gericht nicht auch noch einen Blick aufs Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau geworfen, das von der Uno-Generalversammlung 1979 verabschiedet und 1997 von der Schweiz ratifiziert worden war. Das Übereinkommen präzisiert, was unter Diskriminierung zu verstehen ist. Angewandt auf den Fall der 63-jährigen Belgierin und Ex-Schweizerin, gibt es jedoch ein gewichtiges Problem: Das heutige Recht ist nicht mehr diskriminierend. Es war die frühere, ungerechte Gesetzgebung, die zum Verlust ihres Bürgerrechts führte und heute ihr Aufenthaltsrecht gefährdet.
Kann dies vor Gericht geltend gemacht werden, mit reellen Chancen auf Erfolg?
«Vom Diskriminierungsverbot allein kann kein Aufenthaltsrecht abgeleitet werden», sagt die Berner Rechtsanwältin Barbara von Rütte, die am Max-Planck-Institut in Göttingen über die Staatsbürgerschaft im Völkerrecht forscht. «Im konkreten Fall geht es um die Heilung einer früheren, diskriminierenden Regel, die bis heute nachwirkt. Ein Anknüpfungspunkt ist für die Gerichte schwierig, das sehe ich ein. Aber vielleicht könnte aufgrund dieser Vorgeschichte doch ein Härtefall bejaht werden?»
Von Rütte kennt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, und es ist ihr aufgefallen, dass der Aspekt der Diskriminierung nicht erwähnt wird. Es werde sehr formalistisch argumentiert, findet sie, und es gebe auch keine Auseinandersetzung mit der früheren Bürgerrechtsgesetzgebung: «Das big picture fehlt.»
Welche Auswirkungen das damalige Unrecht hatte, stellt Silke Margherita Redolfi eindrücklich in ihrer jüngst publizierten Dissertation mit dem Titel «Die verlorenen Töchter» dar. Redolfi beschreibt die rechtliche Situation und den Lebensalltag ausgebürgerter Schweizerinnen vor 1953; also jene Zeit, in der das Bürgerrecht automatisch verloren ging und nicht mit einer Erklärung beibehalten werden konnte. Zwischen 1885 und 1953 hätten mehr als 85’000 Schweizerinnen das Bürgerrecht verloren, schreibt die Autorin.
Ein Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Untersuchung ist der Situation jener Frauen gewidmet, die während des Zweiten Weltkriegs wegen der Eheschliessung mit einem Ausländer den Schweizer Pass verloren. Redolfi berichtet unter anderem von Jüdinnen Schweizer Herkunft, die in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten starben – die Schweizer Behörden hatten sie im Stich gelassen.
«Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir leider keine Möglichkeit sehen, in dem von Ihnen gewünschten Sinne in dieser Sache zu intervenieren, da die Frau Berr durch ihre Heirat ihr Schweizerbürgerrecht verloren hat», wird aus einem Schreiben des Eidgenössischen Politischen Departements von 1944 zitiert. Die Eltern der ausgebürgerten Tochter Lea Berr baten die Behörden vergebens um Hilfe. Sie hatten erfahren, dass ihre Tochter, deren französischer Ehemann Ernest und der kleine Enkelsohn Alain in Frankreich von der Gestapo verhaftet und anschliessend deportiert worden waren.
Die Schweizer Tochter wurde am 15. April 1944 in Auschwitz ermordet, zusammen mit ihrem Kleinkind, unmittelbar nach der Ankunft im Lager. Der französische Ehemann wurde für Zwangsarbeiten eingesetzt und ein knappes Jahr später im Konzentrationslager Mauthausen umgebracht.
Urteil des Verwaltungsgerichts F-4332/2018 vom 20. August 2019, noch nicht rechtskräftig.
Illustration: Till Lauer